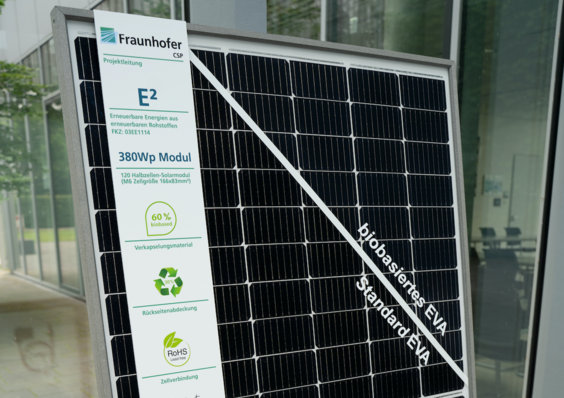Ein halbes Jahr mussten die Ingenieure des Photovoltaik-Prüflabors der Arizona State University, das heute zum TÜV Rheinland PTL gehört, warten. Dann waren die Bedingungen auf dem kargen, nur von ein paar Palmen gesäumten Testgelände endlich perfekt: Die Sonne schien mit 200 Watt pro Quadratmeter, und die Luft war 25 Grad Celsius warm. „Das sind die Bedingungen, mit denen wir das Schwachlichtverhalten jedes Moduls auch im Labor messen“, sagt Thomas Block, Produktmanager bei Schott Solar in Mainz.
Die Änderung des Wirkungsgrads gegenüber jenem, der aus vorgeschriebenen Standard-Testbedingungen (STC: Standard Test Conditions) bei 1.000 Watt je Quadratmeter gemessen wird, muss gemäß der DIN-Vorgabe EN 50380 im Datenblatt mit angegeben werden. Die Outdoor-Messungen bei einem unabhängigen Institut sind dagegen freiwillig. Freiland- und Laborergebnisse stimmen laut Block gut überein. Danach bleibt der Wirkungsgrad der Dünnschichtmodule bei schwachem Licht unverändert, während die kristallinen Schott-Solarmodule rund drei Prozent verlieren.
Auch viele andere Hersteller werben mit höheren Jahreserträgen durch das sogenannte Schwachlichtverhalten derDünnschichtmodule. Schließlich macht die direkte Sonneneinstrahlung im Jahresmittel nur 40 Prozent aus, schwaches Licht vor- und nachmittags, bei Wolken oder Smog aber rund 60 Prozent. Bis zu fünf Prozent mehr Jahresertrag je Kilowattpeak als kristalline Module sollen etwa die Cadiumtellurid-Module des US-amerikanischen Herstellers First Solar unter anderem wegen eines guten Schwachlichtverhaltens liefern. Mitsubishi Heavy Industries aus Japan und Inventux in Berlin, die beide mikromorphe Silizium-Dünnschichtmodule produzieren, geben Mehrerträge von bis zu zehn Prozent an.Messungen des TÜV Rheinland in Köln zeigen jetzt, dass Versprechen dieser Art mit Vorsicht zu genießen sind. „Wir können sie zumindest nicht pauschal bestätigen“, sagt TÜV-Physikerin Ulrike Jahn. Mit ihrem Team testet sie seit Mai letzten Jahres im nationalen Verbundprojekt „Langzeitstabilität und Leistungscharakterisierung von Dünnschichtmodulen“ ein Dutzend Module verschiedener Technologien und Hersteller über viele Monate, im Labor wie auch im Kölner Freiland. Das Projekt wird vom BMU gefördert.
Kein Schwachlichtvorteil
Auf dem Prüfstand stehen zwei kristalline Wafermodule, eines poly-, das andere monokristallin, ein Kupfer-Indium-Disulfid-Modul (CIS), zwei Module aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS), eines aus Cadmiumtellurid und sechs Silizium-Dünnschichtmodule, davon sowohl solche aus amorphem Silizium als auch mikromorphe Module, die zusätzlich zur amorphen noch eine mikrokristalline Schicht haben. „Ein Ziel ist es, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem das Schwachlichtverhalten der Module zuverlässig charakterisiert werden kann“, sagt Jahn. Dazu wollen die Ingenieure herausfinden, wie welche Module unter welchen Bedingungen – Temperatur, Bestrahlungsstärke, Einfallswinkel und Spektrum – wirklich funktionieren. Das ist nicht nur wichtig für den Käufer, der wissen möchte, wie groß seine Stromernte wirklich ausfällt, sondern auch für die Energiewende. Denn um Stromangebot und -nachfrage in Waage und so die Stromnetze stabil zu halten, brauchen die Netzbetreiber möglichst genaue Ertragsvorhersagen. Schwachlichverhalten ist ein Faktor, der umso wichtiger wird, je mehr Anlagen ans Netz gehen.
Die TÜV-Ingenieure haben unter anderem die Energieausbeute der verschiedenen Module für mehrere Monate gegenübergestellt. Um die Werte vergleichen zu können, werden sie auf die Nennleistung der Module bezogen. In Bezug auf den Flächenertrag haben die kristallinen Module wegen des höheren Wirkungsgrades die Nase ohnehin vorn. „Die Unterschiede, die wir zwischen kristallinen und den meisten Dünnschichtmodulen gemessen haben, sind insgesamt sehr klein und das unabhängig vom Wetter“, berichtet Jahn. Manche Dünnschichtmodule fielen gegenüber den kristallinensogar deutlich ab. So ist das Modul mit dem niedrigsten Ertrag ein Dünnschichtmodul. Das mit dem höchsten allerdings auch. Der Unterschied zwischen dem kleinsten und höchsten Ertrag betrug gut 13 Prozent. Die kristallinen Zellen liegen bei den Outdoor-Messungen praktisch gleichauf im oberen Mittelfeld.
Jetzt lassen die Ertragsmessungen noch keinen direkten Schluss auf das Schwachlichtverhalten zu, da noch weitere Umgebungsfaktoren wie die Temperatur und das Lichtspektrum Einfluss haben. Doch auch bei einer direkten Messung der Wirkungsgrade unter schwächerem Licht vormittags am 27. Juni fanden die Wissenschaftler nicht, dass Dünnschichtmodule grundsätzlich besonders punkten. Bei sehr niedrigen Sonneneinstrahlungen zwischen 100 und 200 Watt pro Quadratmeter unterscheiden sich die Änderungen der Wirkungsgrade der getesteten Module am meisten, bezogen auf deren Wirkungsgrad bei Nennleistung. Nur das Cadmiumtellurid-Modul konnte bei den Messungen deutlich gegenüber den kristallinen Varianten punkten. Das bedeutet, dass der Wirkungsgrad bei Schwachlicht deutlich weniger stark sinkt als bei kristallinen. „Aber das muss nicht repräsentativ für die Technologie sein“, betont Jahn. „Nach unserer Erfahrung hängen die Moduleigenschaften nicht nur von der Technologie oder dem Hersteller ab. Sie können sogar von Modul zu Modul der gleichen Baureihe verschieden sein.“ Die physikalischen Größen, die Einfluss auf das Schwachlichtverhalten haben, sind die Widerstände in den Modulen. Je größer der Parallelwiderstand ist, desto weniger geht über Umwege verloren und desto höher ist der Wirkungsgrad. „Das macht sich bei schwachem Licht einfach stärker bemerkbar“, berichtet Jahn. Aber auch der sogenannte Serienwiderstand wirkt sich auf das Schwachlichtverhalten aus. Ein hoher Wert gilt eigentlich als Kennzeichen schlechter Zellen und schmälert den Wirkungsgrad bei hohen Bestrahlungsstärken, zum Beispiel unter Standardtestbedingungen. Bei schwachem Licht wirkt er sich aber nicht so stark aus und der Wirkungsgrad eines Moduls kann sogar steigen. So hat etwa das Cadmiumtellurid-Modul, das bei den TÜV-Messungen besonders gut abgeschnitten hatte, einen besonders hohen Serienwiderstand.
Allerdings hat, wer wie Ulrike Jahn die spezifischen Erträge bestimmenwill, ein ganz anderes Problem. Der spezifische Ertrag ist der Ertrag bezogen auf die Nenn- oder Maximalleistung der Module unter Standardtestbedingungen, wie er meist mit einem Flasher im Laborbestimmt wird. „Dieser Maximalwert für die Modulleistung unter Standardtestbedingungen ist zwar unerlässlich, um die Energieerträge verschiedener Photovoltaikmodule zu vergleichen. Er ist aberauch mit einer großen Unsicherheit behaftet“, sagt sie. „Deshalb liegen die Unterschiede zwischen den gemessenen Energieerträgen häufig innerhalb der Messgenauigkeit.“
Nennleistung sehr ungenau
Die Unsicherheiten sind besonders bei Dünnschichtmodulen groß. Das liegt zum einen daran, dass es nur kristalline Referenzzellen gibt. Diese haben eine andere spektrale Empfindlichkeit als die Dünnschichtzellen, die sich zudem in diesem Punkt je nach Technologie stark voneinander unterscheiden. Man kann zwar versuchen, das mit Farbfiltern auszugleichen – die Frage ist aber, wie man es im Einzelfall macht. Die Referenzzelle befindet sich mit dem zu vermessenden Modul im Flasher und wird dazu benutzt, die Schwankungen der Lichtintensität zu messen und die Messwerte auf den Standard von 1.000 Watt pro Quadratmeter umzurechnen. „Ein ganz kritischer Punkt ist auch die Vorbehandlung der Module“, betont die Projektleiterin. So verliert amorphes Silizium durch Materialalterung in den ersten Monaten deutlich an Leistung. Hinzu kommen saisonal bedingte Leistungsunterschiede.Auch das lässt sich im Prinzip im Labor standardisieren, indem man die Module mit Licht vorbestrahlt und auch die Temperaturen festlegt, die die Module in einem gewissen Zeitraum vor der Messung haben müssen. Allerdings ist auch das zurzeit nirgends festgelegt, so dass jeder vorgehen kann, wie er will. Ulrike Jahn hat sich deshalb dazu entschlossen, die Nennleistung nicht nur mit einem Flasher, sondern auch mit Freilandmessungen zu bestimmen. Das geschieht zu Zeiten, in denen die Sonnenstrahlung sowohl nach ihrem Spektrum als auch nach ihrer Intensität den Standardtestbedingungen möglichst ähnlich ist. Die Methode hat zumindest einen Vorteil: Die Nennleistungen aller Module auf dem Testfeld werden mit den gleichen Einstrahlungen bestimmt und sind relativ gut miteinander vergleichbar.
Auch Gabi Friesen von der Schweizer Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sieht in der Bezugsgröße Nennleistung unter Standardtestbedingungen eine große Gefahr für Schönfärberei. „Die darauf bezogenen Ertragsprognosen werden mehr durch Marktstrategien diktiert als durch die Qualität des Produktes“, berichtet sie in einer aktuellen Studie zum Thema. Die auf die Kilowattpeak-Leistung bezogenen Ertragsdaten könnten zu falschen Schlüssen führen.
Die Schweizer Wissenschaftler hatten ebenfalls Vergleichsmessungen in Labor und Freiland mit kristallinen und verschiedenen Dünnschichtzellen gemacht und sind in Sachen Jahres-Energieausbeute zum gleichen Ergebnis wie die Kölner Ingenieure gekommen: Die meisten Dünnschichtmodule waren auch im Zwielicht nicht besser als die kristallinen Pendants.
Hersteller unbeeindruckt
Hersteller wie Schott oder Inventux fechten die eher ernüchternden Ergebnisse nicht an. Sie bleiben von den Ertragsvorteilen der Dünnschichttechnologien fest überzeugt. „Die Qualität der Module muss allerdings stimmen“, meint Block und verweist auf die erfolgreichen Messungen beim TÜV in Arizona – und auf die Erfahrung. „Schon der Einsatz in Taschenrechnern und Solaruhren zeigt ja, dass die Dünnschichtzellen sogar im Wohnzimmer funktionieren. Das wäre mit kristallinen Zellen gar nicht möglich“, betont er. Eigene Outdoor-Testszeigten zudem: Ob München oder Malaysia, die schlanken Module springen früher am Tag an und beenden ihren Betrieb später. Rein physikalisch lässt sich der Effekt an sich auch nicht bestreiten. Während kristallines Material vor allem bei energiearmen Wellenlängen im Infrarotbereich zur Höchstform aufläuft, verwerten die dünnen Schichten auch energiereicheres Licht mit erhöhtem Blauanteil. Und das schafft es eben auch noch durch Wolken oder Smog und sogar durchs Wohnzimmerfenster auf die Moduloberfläche. Die Frage ist eben nur, welchen Einfluss das auf die Gesamtperformance hat.
Ein Ertragsvorteil der Dünnschichtkandidaten bleibt ohnehin unbestritten: Die weitaus meisten Module büßen bei höheren Temperaturen deutlich weniger ihrer Produktivität ein als die kristallinen Pendants. Die Temperaturkoeffizienten fast aller Dünnschichtmodule aus den TÜV-Messungen waren deutlich kleiner als die der kristallinen Module. Unklar ist wiederum, welchen Anteil welcher Effekt am Gesamtertrag hat. „In Deutschland überwiegt der Schwachlicht-, in Südeuropa der Temperatureffekt“, meint Roland Sillmann, technischer Leiter von Inventux in Berlin, und beruft sich dabei auf Simulationen. Wie stark sich das Schwachlichtverhalten auswirkt, hängt zudem von den Standortbedingungen ab. „Bei einer zehn Grad geneigten Ost-West-Anlage am Standort Würzburg können Sie mit unseren mikromorphen Modulen gegenüber einem typischen kristallinen Modul einen Mehrertrag von über zehn Prozent erreichen“, sagt er. Für neun Prozentpunkte davon sei das gute Schwachlichtverhalten verantwortlich. Die Werte wurden mit dem Simulationsprogramm PV-Sol errechnet. Allerdings berechnen auch die Simulationsprogramme nur Erträge nach den Parametern für das Schwachlicht- und Temperaturverhalten, die die Modulhersteller vorgeben. Als unabhängiger Beweis können die Simulatonsergebnisse daher nicht gelten. Dass sich Dünnschichtmodule wegen des Schwachlichtverhaltens vor allem für Ost-West-Ausrichtungen eignen, gilt in der Branche zwar als ungeschriebenes Gesetz, allerding ist auch das kein Beweis, dass Dünnschichtmodule dabei wirklich einen höheren Ertrag liefern.
So mag Ulrike Jahn auch diese These nicht pauschal bestätigen. „Für einige Dünnschichtmodule ergeben sich tatsächlich Vorteile durch Licht mit erhöhtem Blauanteil. Allerdings werden sie mangels direkter Sonnenstrahlung auch nicht so heiß, und dann kommt auch der bessere Temperaturkoeffizient nicht so stark zum Tragen“, sagt die TÜV-Physikerin. Ganz sicher ist ihrer Meinung nach nur eines: „Es gibt keine Zelle, die überall gleich gut läuft.“