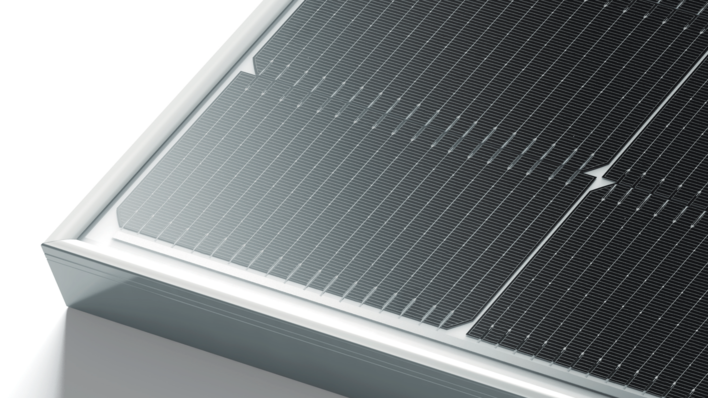Im Herbst 2024 hat der Branchenverband Solar Power Europe in Brüssel den Bericht „Sustainable Solar – Environmental, Social and Governance actions along the value chain“ vorgelegt. Diese nützliche Handlungshilfe verdeutlicht, was der Begriff der Nachhaltigkeit konkret für Solarunternehmen bedeutet und was sie tun können, um die ESG-Regeln umzusetzen. Gemeint sind hohe Anforderungen an ökologische, soziale und Managementstandards.
Umweltauswirkungen, soziale Belange und gute Unternehmensführung: Auf diesen drei Säulen ruht das ESG-Konzept. Die Kriterien sollen finanzielle Risiken senken, die Reputation der Firmen steigern und Erwartungen moderner Kunden erfüllen. In der EU-Taxonomie sind ESG-Kriterien ebenso verankert wie in Richtlinien oder nationalen Vorgaben, zum Beispiel dem Lieferkettengesetz. Mit dem neuen Report will Solar Power Europe „das Wissen über die Nachhaltigkeit der Solarenergie erweitern und dazu beitragen, den EU-Solarsektor als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu positionieren“, wie Raffaele Rossi sagt. Er ist Chefanalyst des Verbands. An der Studie haben 62 Autorinnen und Autoren mitgewirkt. Der große Autorenstab darf nicht verwundern, denn das Thema ist sehr komplex.
Zwangsarbeit für Polysilizium
Zu den sozialen Kriterien gehören die Einhaltung der Menschenrechte und menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der verantwortungsvollen Beschaffung von Materialien und Komponenten. In verästelten Lieferketten wie in der Solarbranche ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, alle Zulieferer überall auf der Welt auf diese Anforderungen einzuschwören.
Solar Power Europe empfiehlt, sich beispielsweise der Solar Stewardship Initiative (SSI) anzuschließen. Sie hat einen Standard zur Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und eine Zertifizierung entwickelt. SSI zielt vor allem darauf ab, Zwangsarbeit bei der Herstellung von Polysilizium auszuschließen.
Soziale Standards für Montageteams
Doch menschenwürdige Bedingungen sind auch eine Aufgabe der in Deutschland ansässigen Solarindustrie. Dies gilt insbesondere für Projektentwickler, die häufig auf ausländische Teams für die Montage zurückgreifen.
Neben der EU-Entsenderichtlinie sind Transparenz und Audits wichtig, um die Beschäftigung sozial abzusichern. Weitere Fragen betreffen die Gleichstellung der Geschlechter oder die Förderung von Vielfalt in der Belegschaft.
Um die Auswirkungen von Produkten und Fabriken auf die Umwelt zu erfassen, hat sich der Carbon Footprint etabliert. Mit dieser Methode wird ermittelt, wie viele schädliche Treibhausgase durch die Herstellung, den Betrieb und das Recycling eines Produkts verursacht werden.
Solarfirmen können ihre Produkte analysieren und gemäß Environmental Product Declaration (EPD) zertifizieren lassen. Speziell für Solarmodule und Wechselrichter vergibt der Global Electronics Council das Epeat-Label, das strenge ökologische Kriterien vorschreibt.
Kreisläufe schließen
Material und Energie – und damit letztlich auch Emissionen – kann man auf zwei Wegen sparen: Man kann den Bedarf für neue Produkte senken, indem man beispielsweise teures Silber ersetzt oder die Waferdicke der Zellen reduziert. Der zweite Ansatz besteht darin, möglichst viel Material aus Recycling einzusetzen. Aluminium oder Gläser lassen sich nahezu beliebig oft einschmelzen und neu verwerten. Zudem spielt die Vermeidung von Abfällen (Verschnitt, Gussreste) eine wichtige Rolle.
Mehr und mehr in den Vordergrund rückt die Reparatur von Produkten. Die Zeit der Wegwerfartikel läuft ab. Moderne Produkte werden so gestaltet, dass man sie reparieren kann. Das mag für Solarmodule weniger zutreffen, bei Wechselrichtern ist es jedoch bereits Standard.
Nutzung von Grundstücken
Auch die Nutzung von Flächen unterliegt ökologischen Kriterien. Solarmodule werden beispielsweise auf ehemaligen Tagebauen montiert, um die Rekultivierung (man könnte auch sagen: das Flächenrecycling) zu unterstützen. Mülldeponien sind ein anderes Beispiel. Häufig unterstützt die Politik die solare Nutzung solcher Flächen. Sind die Flächen durch Munition belastet oder durch Giftstoffe kontaminiert, bieten Solaranlagen einen Ansatz, um die Kosten der Dekontamination zu refinanzieren.
Kombiniert mit landwirtschaftlicher Nutzung, kann Agri-PV die Bodenfruchtbarkeit um bis zu 70 Prozent steigern. Die Solarmodule schützen Pflanzen und Vieh vor übermäßiger Hitze oder Hagel.
Vielfältige Effekte von Floating PV
Schwimmende Anlagen bieten eine weitere Möglichkeit, um knappe Flächen nachhaltig zu nutzen. Sie senken die Verdunstung des Wassers um bis zu 47 Prozent und minimieren das Wachstum von schädlichen Algen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum Gewässerschutz.
Naturnahe Solarparks fördern die Biodiversität und helfen, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Etliche Studien haben gezeigt, dass naturverträgliche Solarkraftwerke die Artenvielfalt um fast 281 Prozent erhöhen können. Sie schaffen Schutzkorridore für Wildtiere, beleben das Gelände mit einheimischen und neuen Arten oder erlauben den Grünschnitt durch Schafherden.
SSI: eine Initiative der Industrie
Dreh- und Angelpunkt ist jedoch die Produktion von Gütern, aus Material, Energie und der Kraft von Maschinen und Menschen. Deshalb haben Solar Power Europe und der britische Verband Solar Energy UK die Solar Stewardship Initiative (SSI) ins Leben gerufen. Darin haben sich Hersteller und Händler zusammengeschlossen. Im vergangenen Jahr hat SSI einen ESG-Standard entwickelt, der für den Einkauf von Solarmodulen gilt.
Bis Ende 2024 wurden mehr als ein Dutzend Modulfabriken mit insgesamt rund 100 Gigawatt jährlicher Produktionsmenge nach dem SSI-Standard bewertet. Die Zertifizierung erfolgt in drei Stufen: Bronze, Silber oder Gold. Hersteller, die Menschenrechte verletzen oder Zwangsarbeiter einsetzen, sind vom Zertifikat ausgeschlossen.
Lieferkette nachverfolgen
Derzeit entwickelt SSI einen Standard für die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette (Supply Chain Traceability Standard). Grundlage sind die ESG-Vorgaben der EU. Entsprechende Zertifizierungen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Derzeit hat SSI rund 50 Mitglieder, darunter 14 Hersteller von Solarmodulen: Aiko, Astronergy, Canadian Solar, DAS Solar, DMEGC Solar, JA Solar, Jinko Solar, JTPV, Longi, Recom, Risen, Solarwatt, Trina Solar und Viridian Solar.
Auch die Hersteller von Wechselrichtern gehen diesen Weg. Fronius aus Österreich will den Anteil europäischer Zulieferer weiter ausbauen. Die Beschaffung von Rohstoffen, Baugruppen und Komponenten orientiert sich an den ESG-Standards. Die Anforderungen an das Material werden kontinuierlich überprüft. Eine spezielle Software hilft, Schadstoffe zu analysieren.
Zudem werden die Kriterien aus Vorschriften wie der Chemikalienverordnung (Reach) und den Richtlinien für Gefahrstoffe in Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen (RoHS) der EU überwacht. Ziel ist es, gefährliche oder bedenkliche Stoffe zu ersetzen.
Fronius stellt hohe Anforderungen
Das betrifft auch Betriebsmittel und Infrastruktur. Kontinuierlich werden die Lieferanten analysiert und bewertet. Darüber hinaus hat Fronius einen Kodex für Geschäftspartner entwickelt, der Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Wertschöpfung definiert und in Verträge integriert. Das dient auch dazu, Risiken zu minimieren.
Logistikpartner werden gleichfalls regelmäßig hinsichtlich Nachhaltigkeit und Performance bewertet. Abweichungen von den geforderten Standards werden durch gemeinsame Maßnahmen angegangen. Lieferanten müssen sich strengen Audits unterziehen und Informationen zur Nachhaltigkeit offenlegen.
https://www.solarstewardshipinitiative.org
https://www.solarpowereurope.org

Foto: Eleonora Cerri Pecorella

Foto: Fronius International
Solarge
Module ohne Gläser und Antimon
Das niederländische Unternehmen Solarge hat Solarmodule entwickelt, die keine persistenten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) enthalten. Die Module sind vollständig recycelbar. Sie können alle Arten von Zellen enthalten, einschließlich Perc, Topcon oder Heterojunction. Die Zellen werden auf einer speziellen Organo-Sandwich-Rückseite montiert und mit einer Polyolefin-Frontfolie abgedeckt.
Die Module verwenden kein Solarglas und enthalten daher kein Antimon. Am Ende ihrer Betriebsdauer werden sie zerlegt und wiederverwertet. Zudem sind die im niederländischen Weert gefertigten Module etwa 50 Prozent leichter als Glasmodule. Im vergangenen Jahr wurden 4.700 dieser Solarmodule mit einer Leistung von insgesamt 2,4 Megawatt auf einem Industriedach in Belgien installiert.
Enel Green Power 3Sun
Modulfabrik liefert drei Gigawatt im Jahr
Trotz der Dumpingpreise aus China gibt es europäische Hersteller, die ihre Fabriken ausbauen wollen. Ein Beispiel ist 3Sun aus Catania auf Sizilien. Der größte Modulhersteller Europas will im Jahr drei Gigawatt Solarmodule für kommerzielle und industrielle Anlagen fertigen. Start der Produktion war im Herbst des vergangenen Jahres. Fünf Linien zu je 600 Megawatt sollen nach dem vollen Ausbau des Werks laufen.
Rund eine Milliarde Euro wurde investiert, davon kamen 190 Millionen Euro von der italienischen Regierung aus Rom. Rund 1.000 Jobs wurden im Werk geschaffen, weitere 1.000 bei Zulieferern und Dienstleistern.
3Sun setzt auf Heterojunction-Zellen (HJT). „Wir wollen Tandemzellen mit 30 Prozent Wirkungsgrad fertigen“, erklärt Dr. Cosimo Gerardi, seit 2011 Forschungschef und CTO von 3Sun. Pro Tag laufen rund 14.000 Solarmodule aus dem Werk.
Im Jahr sind es fünf Millionen Module, mit 300 Millionen Waferzellen, sprich: 800.000 Zellen pro Tag. „Wir haben die Heterojunction-Technik deutlich verbessert, beispielsweise bei der Passivierung und Kontaktierung“, sagt Gerardi. Als praktisches Limit für den Wirkungsgrad von HJT-Modulen gibt er 27 Prozent an, aus der Massenfertigung 25 Prozent. Zudem erlauben HJT-Zellen eine höhere Bifazialität von bis zu 95 Prozent (Topcon: 85 Prozent, Perc: 70 Prozent).
Um die Kosten zu senken, muss vor allem der Bedarf an Energie sinken. 3Sun kann Heterojunction-Zellen mit Temperaturen unter 200 Grad Celsius herstellen. Perc- oder Topcon-Zellen brauchen mehr als 800 Grad Celsius. Zudem ist es gelungen, die Dicke der Wafer von 120 auf unter 90 Mikrometer abzuspecken. Dadurch sinken innere Verluste, der Ertrag gegenüber Perc-Zellen erhöht sich um sechs bis acht Prozent.
Bei einer Testanlage in der sehr heißen Atacama-Wüste in Chile wiesen die Module mit den neuen Zellen nur einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten auf. Dadurch sind sie besonders für warme Regionen geeignet.
Die Heterojunction-Zellen von 3Sun bestehen aus Stapeln aus amorphem und kristallinem Silizium und neuerdings aus amorphem und Nanosilizium, wobei beide Schichten aus Silangas abgeschieden werden. Die sehr feinen Nanoschichten verbessern den Übergang der Ladungsträger.
Die bislang übliche Kristallisation von Ingots aus heißer Schmelze entfällt, ebenso Sägeverluste bei der Trennung der Wafer. Silber zur Metallisierung wird in den Zellen weitgehend durch eine Silber-Kupfer-Paste ersetzt. „Damit haben wir bisher schon 60 Prozent Silber eingespart“, rechnet Cosimo Gerardi vor. „Unser Ziel ist es, weitere 30 Prozent einzusparen. Denn Silber ist sehr teuer.“
Perspektivisch sollen Zellen und Module ohne Silber auskommen. Die Metallisierung aus Kupfer soll über Platingprozesse aufgebracht werden. Die Kontaktfinger schrumpfen auf unter 25 Mikrometer.