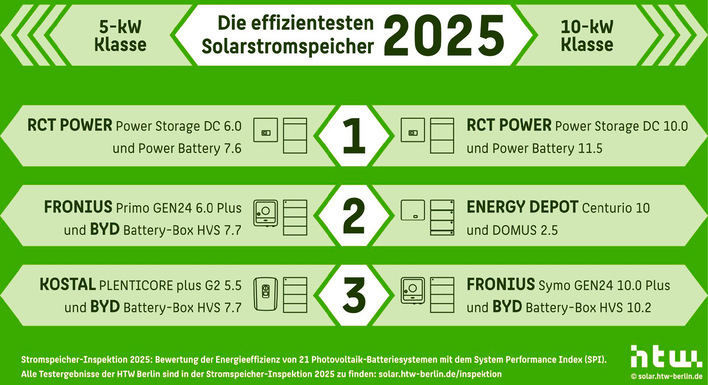Herr Professor Kreusel, immer mehr Industriebetriebe bauen Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf. Ist das eine Entlastung für das Stromnetz?
Jochen Kreusel: Prinzipiell ja. Einerseits ist es natürlich entlastend, wenn einfach Verbrauch und Erzeugung zu gleichen Teilen sinken, die Netzaufgabe also kleiner wird. Andererseits würde ich es aber noch mehr als Entlastung bezeichnen, wenn der Industriebetrieb mit einer relevanten Stromnachfrage am Netz bleibt und diese Nachfrage autark regelt, weil das auch für das Netz stabilisierend wirken kann.
Können Sie das bitte genauer erklären?
Grundsätzlich ist es immer vorteilhaft, wenn Erzeugung und Verbrauch direkt vor Ort ausgeglichen werden. Photovoltaikanlagen stehen in der Regel nah am Verbraucher. Es wäre deshalb sehr hilfreich, wenn die Mittagsspitzen lokal gespeichert werden könnten. Dass die KfW-Batteriespeicherförderung die Einspeisung der Photovoltaikanlagen auf 60 Prozent der installierten Leistung begrenzt, gibt vor diesem Hintergrund einen technisch hilfreichen Anreiz.
Wie weit sind wir noch vom Smart Grid entfernt?
Das hängt davon ab, was man darunter versteht. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine evolutionäre Veränderung nicht nur der Stromnetze, sondern der gesamten elektrischen Energieversorgung und -anwendung sehen werden. Diese Evolution ist heute sichtbar auf dem Weg. Bei der aktiven Einbindung, also der Nutzung für den Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch, von vielen kleinen Elementen – auch auf der Verbraucherseite – sind wir allerdings heute noch nicht. Da stecken wir eher in einer Konzeptphase.
Wo gibt es Fortschritte? Was ist heute bereits smart an unserem Stromnetz?
Wenn es darum geht, Netze zu überwachen, zu führen und zu steuern, sind wir bereits in einer fortgeschrittenen Pilotphase. Während historisch nur die Übertragungsnetze und ausgewählte Verteilungsstationen automatisiert und ferngesteuert waren, setzen die Netzbetreiber immer häufiger solche Lösungen auch in den Verteilnetzen ein. Und das sowohl bei neuen Netzen als auch für die Nachrüstung bestehender Netze. Auch die Abstimmung zwischen der Auslegung der Netze und einer möglichen Abregelung dezentraler Einspeisung im Interesse eines gesamtoptimalen Systems gehört künftig dazu.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für den Ökostromausbau auf Übertragungsebene?
Die Netze auf diesen Spannungsebenen smarter zu machen, ist nicht die Herausforderung. Automatisiertes Überwachen und Steuern gehört für die vier Übertragungsnetzbetreiber schon lange zum Stand der Technik. Es fehlen allerdings zusätzliche Stromautobahnen, die Kapazitätsengpässe beseitigen. Eine große Herausforderung sind die Planungs- und Umsetzungsprozesse, die in der Vergangenheit oft Jahrzehnte gedauert haben. Das muss sich ändern, denn die Netze werden künftig schneller auf Veränderungen auf der Erzeugungsseite reagieren müssen. Das Netz muss den angeschlossenen Erzeugern und Verbrauchern dienen – und nicht umgekehrt. Das Spannungsfeld und der Handlungsdruck sind größer geworden.
Erneuerbare erhöhen den Druck auf das Stromnetz?
So ist es. Wobei die Ursache der schnelleren Veränderungen auf der Erzeugungsseite, die eine entsprechend schnelle Anpassung der Netze erfordern, nicht nur in den erneuerbaren Energiequellen liegt, sondern darin, dass private Investoren in einem entflochtenen System sehr schnell handeln können. In den 90er-Jahren hat es in den USA eine ähnliche Situation gegeben, als zeitgleich viele Investoren Gaskraftwerke gebaut haben. Und auch die aktuelle Verlagerung der Primärenergiebasis in den USA zum Schiefergas geschah sehr schnell und führte dazu, dass die Netze nicht mehr zur Einspeisesituation passten.
Wie sieht es in den Verteilnetzen aus?
Die Verteilnetzstudie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hat gezeigt, dass die Kosten für den Netzausbau begrenzt werden können. Voraussetzung ist, dass die Netze nicht so gebaut werden, dass sie jede Last- oder Einspeisespitze aufnehmen müssen. Der größte Teil der Verteilnetze kann bisher weder überwacht noch gesteuert werden. Überlastungen führen üblicherweise zum Auslösen von Sicherungen, also einer Notfallreaktion. Das ist bis heute die Technik der Wahl in den Verteilungsnetzen.
Die Verteilnetze gelten, überspitzt gesagt, als blind.
Sind sie auch. Dieser Teil der Netze ist faktisch nicht automatisiert. In den deutschen Netzen sind rund 7.000 Stationen ferngesteuert und automatisiert – darunter praktisch keine der über 500.000 Ortsnetzstationen. Im gesamten Netz ist somit nur etwas mehr als ein Prozent der Knoten fernüberwacht und gesteuert, wobei es sich dabei natürlich um die wichtigen Knoten im Netz handelt und der Einfluss der Steuerung für die Betriebsführung dadurch groß ist. Im Rest der Netze werden oft nur die Lastspitzen erfasst, aber der Betreiber weiß nicht, wie oft oder wie lange diese auftreten. Genauere Messungen würden deshalb die Effizienz der Planung für den Netzausbau erhöhen.
Setzen Netzbetreiber nun verstärkt auf Messtechnik?
Dieser Trend ist klar zu sehen. Üblicherweise wirkt der Ausbau der Erneuerbaren als Auslöser. Wahr ist aber: Diese Investitionen würden sich oft auch ohne Ökoenergien lohnen. Man hat den Nutzen nur vorher nicht so klar erkannt.
Was bedeutet die Dezentralisierung der Energieversorgung für das Stromnetz?
Rein technisch bedeutet sie, dass mehr Erzeugungskapazitäten an der Verteilungsebene angeschlossen sind. Künftig müssen diese Einheiten in den Abstimmungsprozess mit einbezogen werden. Heute ist das noch nicht zwingend, denn auf europäischer Ebene ist die Ökostromeinspeisung in Deutschland noch nicht systemkritisch. Deutschland ist keine Insel.
Photovoltaik ist die dezentrale Energiequelle in Deutschland mit der höchsten installierten Leistung. Welche Konsequenzen hat das?
Die Einspeisung ist sehr schwankend. Rund 38 Gigawatt Sonnenstromleistung sind derzeit am Netz. Die Einspeisespitzen innerhalb eines Verteilnetzes treten sehr synchron auf, da es dort keine großen Wettervariationen gibt. Es wäre absolut unwirtschaftlich, die Netze für diese Erzeugungsspitzen auszulegen. Deshalb wird man vor Ort messen und steuern müssen.
Was ist dabei zu beachten?
Zwei Felder: die lokale Spannungshaltung und die Haltung der Frequenz von 50 Hertz, also die systemweite Wirkleistungsbilanz. Die Frequenz kann prinzipiell von überall aus dem Stromnetz beeinflusst werden, vorausgesetzt, es steht ausreichende Netzkapazität zur Verfügung. Das momentan drängendste Problem der Verteilnetzbetreiber ist die Spannungshaltung auf dem Land, und die muss lokal sichergestellt werden.
Können Solarwechselrichter das Netz entlasten?
Die Wechselrichter der Photovoltaikanlagen können Blindleistung bereitstellen und damit zur Spannungsstabilisierung beitragen. Alternativ können auch Maßnahmen im Netz ergriffen werden, wie beispielsweise der Einsatz regelbarer Ortsnetztransformatoren. Es ist dann eine Optimierungsaufgabe, wo im Netz die Unterstützung der Spannungshaltung am besten stattfindet. Zur Frequenzhaltung müssen die Solaranlagen derzeit noch nicht beitragen. Technisch ist das aber vorstellbar und wird an anderen Stellen auch schon gemacht.
Wo zum Beispiel?
Im Stromnetz der Deutschen Bahn, das mit der Frequenz von 16,7 Hertz betrieben wird. Die Bahn hat die rotierenden Umrichter nach und nach durch statische Umrichter, also durch Halbleiterelektronik, ersetzt. Die Frequenzstabilisierung erfolgt elektronisch – und heute bereits fast ohne rotierende Massen. Das Netz wurde erfolgreich umgebaut. Das könnte eine Blaupause für das Stromnetz sein. Ich bin mir sicher, dass wir uns auch auf diese Reise begeben werden.
Wie kommen sie darauf?
Aus der Entwicklung der europäischen Grid-Codes lässt sich das ablesen. Der Umbau läuft.
Welche Bedeutung haben Stromspeicher für das künftige Stromnetz?
Es gibt anscheinend breiten Konsens darüber, dass Speicher gebraucht werden. Allerdings spiegeln das die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen heute nicht wider. Der klassische Geschäftsfall von Pumpspeichern ist verschwunden, da sich die Strompreise an der Börse für Tag und Nacht nur noch wenig unterscheiden. Die Photovoltaik deckt nun die Mittagsspitze ab. Wenn die Solareinspeisung mehr zunimmt, könnte künftig eine Nachtspitze entstehen. Es gibt aber noch weitere Anwendungsfälle und Funktionen für Batteriesysteme, die zum Teil schon rentabel sind.
Das hängt allerdings immer von den regulatorischen Rahmenbedingungen ab.
Und aktuell stammen diese noch aus Zeiten, in denen weder Erneuerbare noch Batterien relevant für beispielsweise Regelenergie waren, sodass Speicher mit ihren Möglichkeiten einfach nicht berücksichtigt wurden. Das Regelwerk gehört in solchen Fällen überprüft und angepasst. Die Diskussionen darüber finden bereits statt.
In welchem konkreten Fall können sich Batteriespeicher lohnen?
Eine Option entsteht, wenn durch Speicher der erforderliche Verteilnetzbau reduziert werden kann. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn die Photovoltaikeinspeisung künftig die lokale Stromnachfrage übersteigt.
Dann könnten Batterien mit der Verschiebung der Stromproduktion Geld verdienen. Das zusammen könnte zukünftig – wenn die Speicherkosten weiter sinken – ein tragfähiges Geschäftsmodell ergeben.
Das Gespräch führte Niels Hendrik Petersen.
Jochen Kreusel
leitet das Smart-Grids-Programm des ABB-Konzerns. Er studierte Elektrotechnik an der RWTH Aachen und wurde dort promoviert. 1994 trat er in den ABB-Konzern ein, wo er leitende Positionen in Marketing und Entwicklung innehatte, bevor er 2011 die heutige Aufgabe übernahm. Kreusel war von 2008 bis 2013 Vorsitzender der Energietechnischen Gesellschaft (ETG) im Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (VDE), seitdem leitet er den Innovationskreis des VDE-Präsidiums.