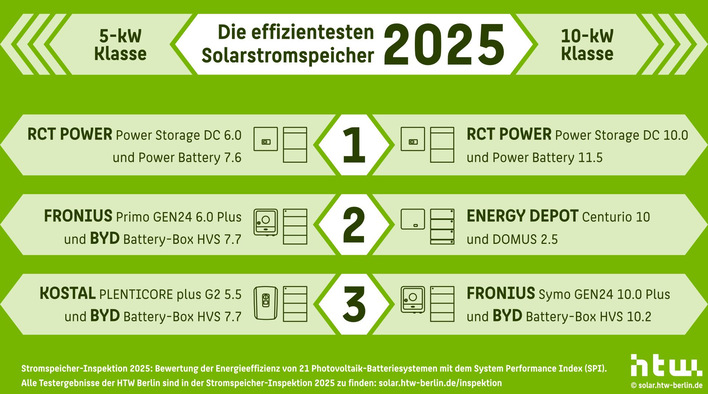Seit September 2024 steht am Bodensee einer der größten Batteriespeicher von Baden-Württemberg. Der Großspeicher kann zehn Megawattstunden aufnehmen und steht auf dem Biohof von Hubert Bechinger. Drei Container nehmen 1.000 nagelneue Batterien auf, die Mercedes aus verschiedenen Gründen nicht in seine E-Autos einbauen konnte.
Der Strom für den Speicher kommt aus einem Solarpark (zwölf Megawatt, zwölf Hektar), der 2022 auf Grünland errichtet wurde. „Zwischen 20 und 100 Prozent der täglich erzeugten Strommenge speisen wir über den Speicher ins Netz, um in Schwachlastzeiten bis zu doppelte Preise zu erzielen“, erzählt Bechinger. Der 41-Jährige ist Bauingenieur und Betreiber des Energiesystems. Bis 2013 arbeitete er als Bauleiter bei Züblin.
Vertragspartner der Netze BW
Schon 2019 war er in die Photovoltaik eingestiegen, um die Kosten für die Haltung von 80 Rindern zu senken. Anfangs plante er eine Anlage mit 750 Kilowatt, später mit zwölf Megawatt. Heute liefert die gut zehn Millionen Euro teure Anlage rund 15 Gigawattstunden im Jahr.
Diese Energie speist Bechinger als Vertragspartner der Netze BW ins öffentliche Netz ein – zu den aktuellen Konditionen an der Leipziger Strombörse. Im Gegenzug erhält er eine Mindestvergütung von 4,16 Cent je Kilowattstunde, sollte der aktuelle Tarif niedriger liegen.
Im Sommer lag der Spitzenwert der Tagesproduktion einmal bei 80 Megawattstunden. Im herbstlichen Hochnebel kommt die Anlage dagegen kaum über fünf Megawattstunden am Tag.
Speicher erzielt höhere Einnahmen
Im Schnitt erhält Bechinger 5,5 Cent für die Kilowattstunde. Wenn im Sommer die Strombörse im Schnitt nur 2,5 bis drei Cent zahlt, profitiert er von der EEG-Förderung. Über den Speicher gibt er dagegen den Strom kaum unter zehn Cent ab. „In der Spitze habe ich im Herbst einmal nach 17 Uhr sogar 82 Cent je Kilowattstunde bekommen“, erzählt er.
Solche hohen Preise werden nur über wenige Stunden gezahlt. Doch 17 bis 20 Cent sind über längere Zeit durchaus zu erzielen. Gebaut hat den Speicher die Firma Tricera bei Dresden.
Sie verwendet Batterien von Mercedes und ist auf Lösungen aus Fahrzeugakkus spezialisiert. „Mir schien das besonders nachhaltig, weil die Batterien nochmals eine Verwendung erhalten, statt entsorgt zu werden“, erläutert Bechinger seine Entscheidung.
Mit Batterien von Mercedes
Die Gespräche seien von Anfang an vertrauensvoll gewesen. Auch von Mercedes habe er nur Gutes über den Partner und die Eignung der Batterien gehört. Allerdings ging der Speicher mit vier Megawatt Leistung erst mit einem Jahr Verzögerung in Betrieb. Die Gründe: Die Firma, die die Erdarbeiten ausführte, hatte damit keine Erfahrung.
Außerdem hatte Covid die Lieferketten eingeschränkt und der Krieg in der Ukraine die Nachfrage nach Akkus erhöht. Die gelieferten Batterien entstammten verschiedenen Serien, die nicht identisch waren. Und schließlich funktionierte die Programmierung nicht auf Anhieb.
0,5C schont das System
Der Speicher kann zehn Megawattstunden aufnehmen. Er wird mit 0,5C beladen und entladen. Beim Füllen und Leeren sind fünf Prozent Reserve programmiert, sodass er mit vier Megawatt über 2,5 Stunden seine Kapazität aufnimmt oder abgibt. „Wir hätten ihn auf 1C einstellen können, um die Füll- und Leerzeit zu halbieren“, sagt Bechinger. „Aber das hätte den Verschleiß erhöht und wäre zulasten der Lebenszyklen gegangen.“
Finanziert wurden Solarpark und Speicher mit zehn Prozent Eigenkapital und zu 90 Prozent über einen Bankkredit. „Ich habe sicher 20 Banken angefragt und viele Gespräche geführt, um schließlich von einer regionalen Geno-Bank das Darlehen zu bekommen“, berichtet der Betreiber. Die meisten Banken hätten das Risiko mangels Erfahrung gescheut oder wegen der Höhe des Kapitalbedarfs oder weil ihr Limit für solche Projekte bereits erreicht war.
Hilfreiche Erfahrungen aus dem Baugeschäft
Bechingers berufliche Erfahrungen im Projektgeschäft haben ihm geholfen. Denn nach seiner Zeit als Bauleiter bei Züblin machte sich der Bauingenieur 2013 als Bauträger selbstständig. Seither hat er gut 30 Wohneinheiten realisiert. 2016 übernahm er 78 Hektar für Land- und Forstwirtschaft, davon 31 Hektar Wald. Auf 47 Hektar weiden 80 Rinder.
Bald erkannte der Bauunternehmer, dass er den Hof nicht profitabel führen konnte, zumal auch die Gebäude marode waren. So kam ihm die Idee, regenerative Energie zu erzeugen. Er beteiligte sich an mehreren Innovationsausschreibungen und bekam die Zuschläge.
Etliche Regeln zu beachten
Im Gegenzug muss er etliche Regeln beachten. So darf er beispielsweise den erzeugten Solarstrom nicht an Dritte verkaufen. Er darf nur eigenproduzierten Strom speichern und muss in den ersten zehn Jahren täglich mindestens acht Megawattstunden liefern. Dafür leistet der Speicher wertvolle Dienste, gerade wenn es im Herbst und Winter bewölkt und neblig ist.
Mittlerweile hat Bechinger rund 100 Anfragen von Landwirten aus seiner Region bekommen, die seinem Beispiel folgen wollen. Aus den Gesprächen haben sich bislang fünf konkrete Projekte ergeben, alle maximal eine Autostunde von ihm entfernt. Eine Anforderung, die der Berater aus ökonomischen Gründen stellt: Die Solaranlage muss auf mindestens acht Megawatt ausgelegt sein. Die aktuell größte leistet 25 Megawatt. Als Faustformel gilt: ein Megawatt pro Hektar.
Viele Ansätze für neue Projekte
Dabei ist der Oberländer für alle Ansätze offen: als Projektentwickler, als Betreiber oder als stiller Teilhaber. „Manchmal wollen die Landwirte nur die Pacht“, erzählt er. „Dann wollen sie mit der Investition, mit den Regularien der Einspeisung und dem Risiko nichts zu tun haben.“
Derzeit seien je nach Beschaffenheit des Geländes und der Infrastruktur zwischen 3.000 bis 4.500 Euro Pacht pro Hektar erzielbar. Zeitweise wurden 8.000 Euro geboten, doch zwischenzeitlich ist der Markt gegenläufig.
Grünland ist demnach besser geeignet als Äcker, weil deren Erträge geringer sind. Wichtig seien stabile Bodenbeschaffenheit, geringer Neigungswinkel und Mindestgröße. Daneben seien die Bereitschaft der Kommune, den Flächennutzungsplan zu ändern, und die Akzeptanz der Bevölkerung wichtig für das Gelingen. Im Gegenzug winken Versorgungssicherheit mit Strom, Gewerbesteuer und Arbeitsplätze.
Minderwertige Böden im Blick
Günstig für die Akzeptanz von Solarparks ist es, wenn minderwertige Böden und Wiesen genutzt werden, die als Weiden dienen. In Bechingers Anlage sind die Solarmodule auf 0,8 Metern Höhe installiert. Das hält den Bedarf an Stahl und Kabeln gering.
Übrigens: Jetzt plant der findige Unternehmer auf seinem Land eine Windkraftanlage mit 7,8 Megawatt Leistung samt Speicher. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro. Dann ist er auch lieferfähig, wenn die Sonne nicht scheint.