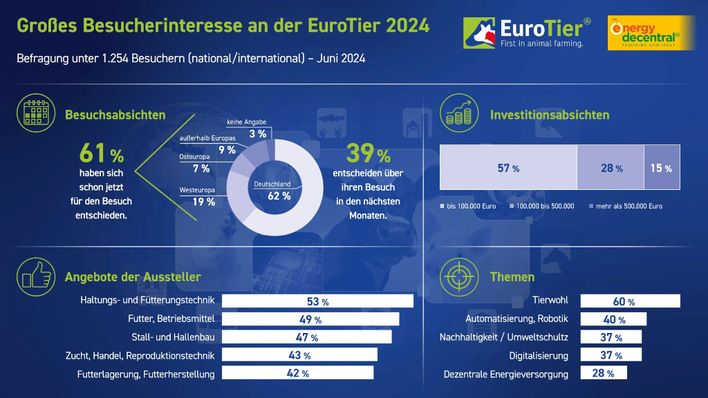Der neue Begriff Moor-Photovoltaik bezeichnet die gleichzeitige Nutzung wiedervernässter Moorböden für Klimaschutz und Solarstromerzeugung. Das Projekt Moorpower soll nun Handlungsempfehlungen zur konkreten Umsetzung von Moor-Solar erarbeiten. Denn die parallele Planung der Photovoltaikanlage und der Wiedervernässung seien absolutes Neuland, erklärt Agnes Wilke, Projektleiterin für Moor-Photovoltaik am Fraunhofer ISE.
Solarmodultypen und Fundamente
Das Projekts soll dabei auf verschiedenen Maßstabsebenen Erkenntnisse gewinnen: Auf einer Testfläche in Mecklenburg-Vorpommern bauen Forscher auf sechs Hektar verschiedene Anlagendesigns auf einem noch landwirtschaftlich genutzten Niedermoor. Sie vergleichen dabei unterschiedliche Aufständerungshöhen, Solarmodultypen und Fundamente. Jede Anlagenvariation wird dann in Kombination mit drei unterschiedlichen Wasserständen untersucht.
Fraunhofer ISE: Hersteller geben Modulleistung oft zu hoch an
„Wichtig ist, für die Doppelnutzung aus Kohlenstoffspeicherung im Torf und Produktion erneuerbarer Energie per Photovoltaik nur entwässerte und stark degradierte Moorflächen zu erschließen, also die derzeit landwirtschaftlich genutzten Moorböden“, sagt Professor Jürgen Kreyling von der Uni Greifswald. Moorböden müssten vor der Installation von Photovoltaikanlagen wiedervernässt werden, damit die Treibhausgasemissionen aus den Moorböden reduziert oder verhindert werden.
Schwimmende Solarkraftwerke: Sauberer Strom von sauberen Gewässern
Aktuell sind rund 70 Prozent aller Moore hierzulande für die landwirtschaftliche Nutzung trockengelegt. Sie tragen jährlich zu rund 44 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft bei. Um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, müssten mindestens 50.000 Hektar Moorfläche pro Jahr wiedervernässt werden.
Förderung durch die Bundesregierung
Auf einer Materialtestfläche in Baden-Württemberg kann das Projektteam unterschiedliche Materialien, Beschichtungen und Methoden für die Fundamente der besonderen Solaranlagen kleinflächig testen. Zudem werden die Auswirkungen der Beschattung durch die Anlagen auf die moortypischen Pflanzen in Topfversuchen untersucht. Auf einer rund 200 Hektar großen Fläche mit Photovoltaik auf Moor in Niedersachsen gehen die Wissenschaftler den großflächigen Prozessen nach, wie beispielweise der Treibhausgasbilanz auf Landschaftsebene.
EU-Kommission nimmt Photovoltaik in die Landwirtschaftsstrategie auf
Zu den beteiligten Fachbereichen des Projekts gehören Photovoltaik, Ökonomie, Jura, sowie ein breites Spektrum der Ökologie mit Themen von der Hydrologie über Biodiversität und Pflanzenwachstum bis hin zu Treibhausgasen. Dabei untersucht das Projektteam auch die Möglichkeit einer zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächennutzung auf Moorkulturen. Seit 2023 fördert die Bundesregierung den Bau von Solaranlagen auf ehemals für die Landwirtschaft trockengelegten Moorflächen, wenn diese dabei dauerhaft wiedervernässt werden. (nhp)