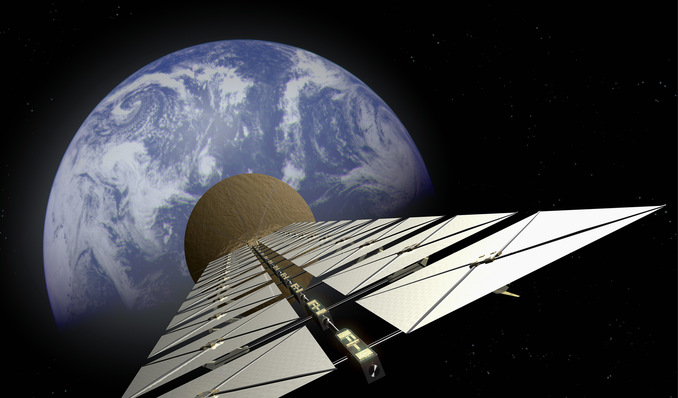Sie sind ein alter Hase in der Solarbranche, gehörten zu den Pionieren der Modulfertigung. Seit wann sind Sie mit Dünnschichtmodulen unterwegs?
Nikolaus Meyer: Während meiner Promotion am Hahn-Meitner-Institut in Berlin bis ins Jahr 2000 haben wir die Technologie zur Anwendungsreife gebracht. Die Entwicklung des Dünnschichtkonzepts war schon während der 90er-Jahre erfolgt. Ich habe die erste Pilotfertigung geplant und Investoren gesucht. 2003 war es dann so weit. Wir hatten das Geld zusammen. Als Schlüsselinvestoren konnte ich Vattenfall und M+W Zander gewinnen.
Damals hieß die Firma Sulfurcell. Welche Ziele hatten Sie seinerzeit?
Wir haben die Labortechnologie für Kupfer-Indium-Sulfid-Module auf kommerzielle Module hochskaliert, erste Prototypen gefertigt und an Testkunden ausgeliefert. Ende 2005 lieferten wir die ersten CIS-Module an Großhändler aus, an IBC Solar und Krannich, das waren unsere Partner, auch in der Entwicklung der Produkte.
Ich erinnere mich, damals habe ich Ihre Fabrik zum ersten Mal besucht. Dünnschichttechnik mit Kupfer-Indium-Sulfid-Halbleitern schien noch sehr futuristisch ...
Es war eine Pilotproduktion mit rund drei Megawatt Jahreskapazität. Wir erzielten einen guten Durchsatz, eine gute Ausbeute und haben robuste Prozesse für die Massenfertigung entwickelt. Im Jahr 2008 war die Massenfertigung machbar, auch lagen vielversprechende Erfahrungen mit unseren Modulen aus Anlagen vor. Die technischen Risiken waren beherrschbar, also konnten wir die Großserienfertigung planen.
Was meinen Sie mit Großserie?
Wir suchten nach Investoren für eine 35-Megawatt-Fabrik, die wir in Berlin-Adlershof aufbauen wollten und schließlich aufgebaut haben. Intel Capital und Climate Change Capital stiegen als Ankerinvestoren ein, wir bekamen 85 Millionen Euro Eigenkapital zusammen, aus ganz Europa. Das lief planmäßig, wie übrigens die ganze Entwicklung zuvor.
Wann lief es nicht mehr nach Plan?
Im Jahr 2009 kamen die Modulpreise zum ersten Mal ins Rutschen, gleich um 40 Prozent. Zwar hatten wir sinkende Preise prognostiziert, aber nicht diese Talfahrt. In unserem Businessplan waren pro Jahr gut zehn Prozent Preisverfall einkalkuliert. 2011 folgte der nächste Preissturz um 40 Prozent. In diesem Jahr firmierten wir in Soltecture um. Doch unser Geschäft geriet zunehmend in Schieflage.
Lag es nur am Preisverfall?
Der Preisverfall und die Marktsituation waren entscheidend. Die technologischen Herausforderungen ließen sich managen. Unser ursprüngliches Produkt mit Schwefel erzielte nicht die erforderlichen Wirkungsgrade, also stellten wir auf Selen um. Das hatten wir eigentlich erst viel später geplant, mussten diesen Schritt aber nun vorziehen. Ich konnte eine weitere Finanzierung von 19 Millionen Euro akquirieren, um zusätzliche Maschinen in die Linien zu integrieren. So konnten wir sehr schnell die zweite Generation unserer Produkte in die Produktion und auf den Markt bringen. 2012 erreichten wir einen mittleren Modulwirkungsgrad von zwölf Prozent. Der Spitzenwert lag bei 13 Prozent, auf die Aperturfläche gerechnet sind das sogar 14 Prozent. Aber durch den weiteren Preisverfall und die geringe Skala unserer Fertigung gelang es nicht, kostendeckend zu fertigen. Das für Anfang 2012 geplante Hochfahren der Fertigung auf 20 bis 30 Megawatt konnten wir nicht mehr stemmen.
Also waren Sie hauptsächlich ein Opfer des mörderischen Preiskampfes?
Aufgrund der Dumpingpreise der chinesischen Anbieter konnte man 2012 mit der Modulproduktion nur Geld verbrennen. Geld, das wir ohnehin nicht hatten. Wir haben uns auf dem Markt auf Premiumlösungen für solares Bauen konzentriert und gleichzeitig nach einem strategischen Investor mit langfristiger Perspektive und ausreichender Kapitalkraft gesucht. Das sah im ersten Halbjahr 2011 noch sehr gut aus, wir hatten zahlreiche Verhandlungen mit asiatischen Investoren und sogar Vorverträge. Aber im zweiten Halbjahr 2011 haben viele potenzielle Investoren ihre Pläne zur technologischen Diversifizierung auf Eis gelegt, um die Marktkrise auszusitzen. Letztendlich hatten wir keinen Erfolg, trotz sehr guter Bewertungen unserer Technologie und unseres Produktportfolios in der Due Diligence. In diesem Umfeld konnten wir nicht gewinnen.
Wie viele Mitarbeiter hatten Sie, als Sie Insolvenz anmelden mussten?
Anfang Mai 2012 stellten wir den Insolvenzantrag, damals hatten wir noch rund 170 Mitarbeiter. In den besten Zeiten waren es 260. In den drei Monaten der vorläufigen Insolvenz haben wir weiter Kleinserien gefahren und den Schwung beibehalten. Eine Woche vor der Stilllegung im August 2012 holten wir unsere besten Module aus der Linie. Aber es reichte nicht. So mussten wir die Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft überführen. Die Maschinen werden im Juli versteigert. Das Gebäude ist von der Insolvenz nicht betroffen, das gehört der Bank.
War damit auch Ihre Arbeit beendet?
Nein. Ich habe nach der Stilllegung den Insolvenzverwalter beraten und zwei alternative Businesspläne verfolgt. Zum einen die Expansion in eine wirklich große Fabrik, die die Kostenvorteile der Dünnschichttechnologie realisieren würde. Aber solche Pläne sind im aktuellen Marktumfeld nicht finanzierbar. Zum anderen haben wir versucht, etwa zehn Millionen Euro für zwei bis drei Jahre zu gewinnen, um die Firma als Technologieanbieter über Wasser zu halten. So ließe sich der Wert aus zehn Jahren CIGS-Entwicklung bewahren und die Technologie weiterentwickeln. Auch das klappte in der Kürze der Zeit nicht - das war enttäuschend.
Wenn Sie zurückblicken: Was hat Sulfurcell respektive Soltecture das Genick gebrochen?
Wir wurden vom schnellen Verfall der Modulpreise überholt. Die Chinesen haben ihre Produkte mindestens 30 Prozent unter ihren Kosten verkauft, da konnten wir nur Verluste produzieren. Diese Herausforderung hat alle Modulhersteller getroffen. Wer mit den Chinesen mithalten will, muss in ihrer Größenordnung mitspielen. Für die CIS-Technologie ist daher Solar Frontier ein Hoffnungsträger. Die Firma kann im Jahr ein Gigawatt fertigen und müsste sehr wettbewerbsfähige Kosten erreichen können. Vor allem aber stützt sich Solar Frontier in Japan derzeit auf einen sehr starken Heimatmarkt, in dem die chinesischen Module kaum eine Chance haben. Das hätte ich mir auch für Deutschland gewünscht.
Sie werden in Kürze 42 Jahre alt, viel zu früh, um sich zur Ruhe zu setzen. Wie gehen Sie persönlich mit dem Scheitern um?
Vorerst bleibe ich nicht in der Photovoltaikbranche, aber das muss kein Dauerzustand sein. Ich fühle mich den erneuerbaren Energien weiterhin verpflichtet, dort liegt meine Zukunft. Mittlerweile liegt das Ende von Soltecture schon elf Monate zurück. Drei Jahre lang habe ich um das Überleben der Firma gekämpft. Nun bin ich froh, nach vorn blicken zu können. Und um es einmal klar zu sagen: Es waren zehn spannende und erfolgreiche Jahre. Wir hatten ein Spitzenteam und haben am Markt und technologisch viel erreicht, bis in die letzten Tage von Soltecture.
Was würden Sie heute anders machen, aus dem Rückblick heraus?
Wir hätten Hellseher sein müssen, um die rasante Marktentwicklung vorauszuahnen. Dann hätten wir den Bau der neuen Fabrik stoppen können, um das Geld zusammenzuhalten und als Technologieentwickler die Marktkrise zu überstehen. Aber wer ist dazu in der Lage?
Wie sehen Sie die Zukunft der Dünnschichtbranche?
Dieses Segment steht und fällt damit, ob die Modulhersteller die Wirkungsgradlücke zum polykristallinen Silizium bald schließen können. Zwar spielen die Modulpreise bei den Anlagenkosten immer weniger eine Rolle. Aber die Systemkosten hängen wesentlich vom Wirkungsgrad ab, und geringerer Wirkungsgrad erfordert größere Flächen, mehr Material und mehr Arbeit, um die gleiche Leistung zu installieren. Modulwirkungsgrade von über 15 Prozent sind mit der CIGS-Dünnschicht machbar. Wenn man bedenkt, dass wir den Wirkungsgrad der Soltecture-Module jedes Jahr um 1,5 Prozentpunkte hochgeschraubt haben, ist das realistisch. Solar Frontier und Manz haben schon Module mit 16 Prozent hergestellt. Da muss die Reise hingehen.
Das Interview führte Heiko Schwarzburger.
Dr. Nikolaus Meyer
hat im Jahr 2000 über Dünnschichtmodule mit Kupfer, Indium und Schwefel promoviert. 2003 gründete er die Firma Sulfurcell im Berliner Stadtteil Adlershof, als Start-up aus dem Hahn-Meitner-Institut. Sulfurcell baute eine Pilotfertigung auf. Später wuchs das Unternehmen und firmierte in Soltecture um. Erstmals seit der Insolvenz äußert er sich öffentlich zu den Gründen des Scheiterns und den Aussichten der CIGS-Technologie.