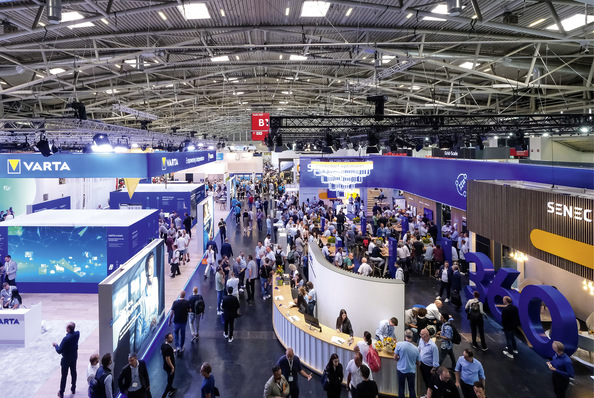Herr Ibsch, was haben Planer und Betreiber beim Netzanschluss von Großspeichern zu beachten?
Marko Ibsch: Grundsätzlich ist erstmal relevant, ob der Speicher rein für die Eigenverbrauchsoptimierung eingesetzt werden soll oder ob er auch Strom ins Netz einspeist. Der Rest läuft dann ähnlich ab wie bei einer großen Solaranlage. Der Batteriewechselrichter wird wie ein Solarwechselrichter behandelt und ist damit auch Teil des Regelungs- sowie des Schutzkonzepts.
Was gilt bei einer Kombination von Speicher und Solaranlage?
Sofern der Speicher parallel zur Solaranlage einspeisen kann, werden die Leistung der Solaranlage und die Einspeiseleistung des Speichers zusammengerechnet. Die Summe der beiden Werte entscheidet darüber, welches Anlagenzertifikat benötigt wird. Wenn die Solaranlage beispielsweise eine Wechselrichterleistung von 600 Kilowatt hat und der Speicher ebenfalls 600 Kilowatt ins Netz einspeist, liegt das Gesamtsystem bei 1,2 Megawatt und damit im Bereich des Anlagenzertifikats Typ A. Liegt die Leistung der beiden Systeme unter 950 Kilowatt, benötigt der Betreiber nur ein Anlagenzertifikat Typ B.
Und wie kann KI bei der Netzintegration schon heute helfen?
Eine Künstliche Intelligenz ist sehr gut darin, große Datenmengen schnell zu sichten und auf verschiedene Prüfpunkte zu untersuchen. In der Elektrotechnik ist fast alles mit Schlüsselwörtern und DIN-Zeichen versehen und standardisiert – das hilft natürlich. Die KI sorgt schon heute dafür, dass der gesamte Zertifizierungsprozess schneller, einfacher und transparenter abläuft. In Zukunft ist es sogar möglich, dass eine KI die Prüfungen quasi in Echtzeit durchführt. Technologisch ist das kein großes Problem, es fehlen aktuell nur die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür. (nhp)
Weitere aktuelle News:
EWS-Analyse: Klare Signale fehlen
Zerez: Register für Zertifikate ab Februar 2025 verpflichtend