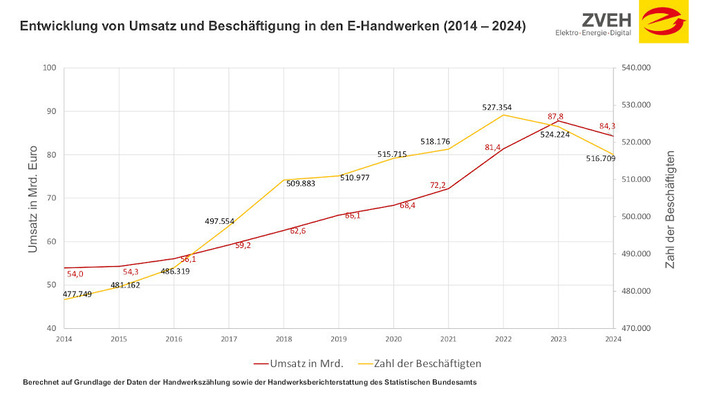Wir treffen Professor Rutger Schlatmann in seinem Büro mit Südausrichtung in Berlin-Adlershof. Wenn die Sonne scheint, ist es lichtdurchflutet. Heute ist ein trüber Tag voller Wolken, keine Sonne weit und breit – symbolisch für die Lage in der Photovoltaikbranche. Durch den harten Wettbewerb steigen allerdings wieder die Aktivitäten in Forschung und Entwicklung. Das Kompetenzzentrum Dünnschicht- und Nanotechnologie für Photovoltaik Berlin (PVcomB) von Schlatmann forscht dabei an zwei verschiedenen Dünnschichttechnologien: Einmal Kupfer-Indium-Gallium (CIS) oder Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) und zweitens an amorph-kristallinen Siliziumzellen.
Welche Wirkungsgrade können bei der CIS/CIGS-Technologie erreicht werden?
Rutger Schlatmann: Im Labor sind Werte von klar über 20 Prozent durchaus drin. Einige haben das schon geschafft. Wir am Helmholtz-Zentrum liegen im Moment noch etwas darunter.
Zum Vergleich: Bei welchem Wert liegt amorph-kristallines Silizium?
Für Tandemzellen aus amorph-kristallinem Silizium liegen wir bei 12,1 Prozent – dicht am Weltrekord von der Firma Kaneka aus Japan mit 12,3 Prozent. Hier arbeiten wir an einer Weiterentwicklung. Mithilfe einer Laser-Kristallisation können fünf bis zehn Mikrometer dünne Siliziumschichten auf Glas aufgebracht werden. Diese sind zwar klar dicker als amorphes Material, aber viel dünner als die herkömmlichen Wafer.
Wo liegt der Vorteil der Entwicklung?
So können das Wissen der etablierten Massenfertigung von Wafern und die Vorteile der auf Siliziumdünnschicht basierenden Technologie kombiniert werden. Denn auch bei den Wafern ist der Trend klar: Materialeinsparungen senken die Kosten, gerade bei einer Massenproduktion im Gigawattbereich. Langfristig, denke ich, kann im Bereich der Solarzellen aus kristalliner Siliziumdünnschicht auch ein Wirkungsgrad von 20 Prozent pro Zelle erreicht werden. Kurzfristig sehe ich ihn bei 14 Prozent.
Wie funktioniert das Verfahren genau?
Mit Elektronenstrahlverdampfung oder einem anderen schnellen Prozess beschichtet man Glas mit amorphem Silizium. Die elektronische Materialqualität muss nach der Abscheidung noch nicht einmal so hoch sein wie bei amorphem Silizium, sodass sich die Schicht sehr schnell abscheiden lässt. Dann fährt der Laser oder der Elektronenstrahl mit einer hohen Geschwindigkeit von einem Zentimeter pro Sekunde über das Material. Das Silizium schmilzt, aber nicht das Glas darunter, obwohl der Schmelzpunkt von Glas deutlich niedriger ist als von dem Halbleitermaterial. Die Energie wird dabei sehr zielgerichtet eingesetzt, sodass der Elektronenstrahl das drei Millimeter dicke Glas gar nicht ganz aufheizt. Beim Abkühlen erstarrt das Silizium in bis zu ein Zentimeter große Kristallkörner. Dieses Verfahren ähnelt dabei dem Kristallziehen in der Waferherstellung.
Worauf muss dabei geachtet werden?
Das Interface, also die Schicht an der Glasseite, sollte möglichst gut sein, da es kaum mehr nachbearbeitet werden kann. Das ist ein Unterschied zum Wafer, bei dem beide Seiten später noch nachbearbeitet werden können. An der Rückseite werden dann die Kontakte gesetzt, ebenso wie bei Wafern, nur eben auf Glas. Unsere Wirkungsgrade bei kristallinem Silizium auf Glas liegen bei neun Prozent, Forscher in Australien von der University of South Wales kommen auf knapp zwölf Prozent. Aber die Prozentgewinne schreiten zurzeit sehr schnell voran. Die glasbasierten Zellen oder Module müssen dennoch beim Wirkungsgrad näher an die kristallinen herankommen. Die Rekorde liegen bei beiden Technologien CIGS und Wafer über 20 Prozent, aber die Herstellungsverfahren sind bei den Wafern besser entwickelt. Mit Siliziumdünnschicht sind wir derzeit noch einen Schritt zurück.
Wo sehen Sie künftige Märkte für CIGS-Module?
Neue Märkte, bei denen flexible Module zum Einsatz kommen, sind eher schwierig zu erschließen. Das Material müsste idealerweise schon mit einem Dachelement in der Fabrik kombiniert werden. Seit Langem gibt es da immer wieder Pilotprojekte, doch bislang sind die meisten Versuche gescheitert. Das ist meiner Meinung nach ein anderes Produkt, das sich nicht dem Wettbewerb mit Glasmodulen stellen muss, weil es rund 80 bis 90 Prozent leichter ist. Die Plastikmodule können auf Dächern mit deutlich geringerer Tragfähigkeit integriert werden, wo keine Glasmodule zum Einsatz kommen können.
Gibt es weitere Einsatzgebiete?
Das Thema gebäudeintegrierte Photovoltaik bietet insgesamt neue Möglichkeiten. Aber bisher ist das eine zähe Angelegenheit. Die traditionelle Bauwelt mit ihren eigenen Normen und Vorschriften trifft auf Modulhersteller. Bisher waren die Glasgrößen der Fabriken relativ einheitlich. Wahrscheinlich wird es so kommen, dass die Modulhersteller noch flexibler in der Produktion werden müssen. Auch Glasfassaden lassen sich mit der Dünnschichttechnologie sehr gut verbinden. Wir arbeiten beispielsweise zusammen mit einer Firma an einem neuen Verfahren, bei dem erst das Glas beschichtet wird und dann die Strukturierung in Zellen erfolgt. Dadurch kann ein Teil der Module für einen bestimmten Kunden anders produziert werden, ohne hohe Mehrkosten. Diese Flexibilität gibt es nur bei der Dünnschichttechnologie.
Wo sehen Sie Nachteile bei den flexiblen Materialien?
Bei Glasmodulen ist erwiesen, dass diese 30 Jahre und mehr halten, da das Material witterungsbeständig ist. Niemand zweifelt daran. Bei flexiblen Schichten ist das nicht so. Es müssten Teflon-ähnliche Schichten zum Einsatz kommen. Das ist schwieriger umzusetzen, obwohl es auch hier zertifizierte Produkte gibt. Die Erfahrung mit solchen Produkten ist einfach noch nicht so groß.
Was muss passieren?
Es ist wichtig, dass die Wirkungsgrade immer weiter steigen, weil das Modul unter einem gewissen Effizienzgrad für null Euro oder weniger angeboten werden müsste, um die gleichen Solarstromkosten erreichen zu können im Massenmarkt. Will das Unternehmen da Geld verdienen, müssen höhere Effizienzen erreicht werden. Einige Aktivitäten scheiden somit von vornherein aus, weil klar ist, dass damit in Zukunft kein Geld verdient werden kann. Überspitzt gesagt, für Module mit fünf Prozent Wirkungsgrad gibt es keine Märkte in direkter Konkurrenz zu den Wafern. Wobei es durchaus Nischen geben kann, wo der Wirkungsgrad nicht alleine diese entscheidende Rolle spielt.
Derzeit kämpfen viele Solarunternehmen ums Überleben. Ist Ihr Institut auch von der Krise betroffen?
Ja, ganz klar. Derzeit hat das auch negative Folgen für uns. Es sind Projekte ausgefallen. Unsere wichtigsten Partner im Bereich Dünnschichtsilizium, Masdar und Inventux, sind noch am Markt – da haben wir auch Glück gehabt. Aber es gibt auch positive Zeichen: Durch die vielen Übernahmen entwickeln sich neue Forschungsaktivitäten. Aber es ist natürlich besser für ein Forschungsinstitut, wenn es, wie zwischen den Jahren 2000 und 2008, immer nur bergauf geht für die Branche.
Wie finanziert sich Ihr Institut?
Der Anteil an privaten Aufträgen, vor einigen Jahren die Hauptquelle, ist derzeit kleiner geworden. Durch unsere Eingliederung in das Helmholtz-Zentrum haben wir aber auch eine gesicherte Grundfinanzierung. Eine dritte Quelle sind öffentlich-private Förderprojekte.
Wie nah ist Ihre Forschung am Markt?
Wir haben im Kern zwei Forschungslinien, die einige Module mit den Maßen 30 mal 30 Zentimeter am Tag produzieren können, basierend auf Silizium und CIGS. Durch die beiden Linien lassen sich sehr gut Alternativen erproben. Einerseits können wir CIGS-Module durch Kathodenzerstäubung herstellen. Das ist die herkömmliche Methode, die auch Unternehmen wie Solar Frontier, Avancis und Bosch Solar anwenden.
Was machen Sie anders?
Wir wollen die Schichten auch drucken. Oder mit ganz anderen Materialien testen. Langfristig könnte Indium durch Zinn-Zink ersetzt werden. Das würde die Kosten deutlich senken, aber so weit sind wir derzeit noch nicht. Die Halbleiterstruktur ist im Labor zwar ähnlich, allerdings noch nicht so gut wie bei CIGS.
Warum testen Industrieunternehmen bei Ihnen?
Bei uns kann einfacher getestet werden, weil die Produktion der Firmen nicht extra unterbrochen werden muss. Dennoch bekommt die Firma ein statistisch relevantes Ergebnis auf hohem Niveau, mit dem sie die Fertigung weiterentwickeln kann. Neben direkten Zahlungen der Firmen an unser Institut ist es wünschenswert, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Denn so können wir nachweisen, dass wir auch unserem öffentlichen Auftrag gerecht werden. Für uns ist das neben dem wissenschaftlichen Wert auch Werbung und damit auch eine Art zweite Währung. Gleichzeitig erhöht die Firma darüber hinaus ihre Repräsentation.
Werden alle Testergebnisse veröffentlicht?
Nein, nicht alle. Für Masdar PV beispielsweise haben wir viele Tests gemacht, die unter Verschluss blieben. Bei einer öffentlichen Förderung wie durch die Innovationsallianz Photovoltaik kann meist alles veröffentlicht werden – und das ist auch gut so.
Mit welchen Unternehmen arbeiten Sie zusammen?
Mit Bosch und Manz sind wir derzeit in einem öffentlichen Projekt. Zudem kooperieren wir mit Masdar PV, Heraeus, Inventux und einer kleinen Firma aus unserem Gebäude, Plasmetrex. Die bauen Analysegeräte für Plasmaabscheidungsverfahren.
Zuvor haben Sie auch einige Jahre beim Chemieunternehmen Akzo Nobel geforscht. Wie unterscheidet sich die Arbeitsweise?
Die Währung bei einem Unternehmen ist immer das verdiente Geld. Es wird genau geschaut, wo investiert wird und was herauskommt. Dabei ist die Arbeit einspurig auf ein Ziel gerichtet. Neue Ideen haben dagegen in einem Forschungsinstitut mehr Freiraum. Für uns am PVcomB sind auch die Patente und Veröffentlichungen Teil unseres Erfolgs.
Das Gespräch führte Niels Hendrik Petersen.
pvcomB
Forschung nah am Markt
Das Kompetenzzentrum Dünnschicht- und Nanotechnologie für Photovoltaik Berlin (PVcomB) ist eine gemeinsame Initiative des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie (HZB) und der Technischen Universität Berlin. Das Institut betreibt Labore zusammen mit zwei anderen Hochschulen, der HTW und der TU Berlin. Das Helmholtzzentrum Berlin ist dabei auf langfristige Grundlagenforschung ausgelegt, die Projekte laufen meist fünf Jahre. Dort werden neue Prozesse und Materialien erforscht, die meist nicht innerhalb der nächsten Jahre am Markt sind. Das PVcomB bearbeitet dagegen auch Fragen aus der Industrie. Das Institut in Berlin-Adlershof hat derzeit 35 Angestellte und 15 studentische Hilfskräfte.
Zentrum für Sonnenenergie- und WasserstoffForschung
Neues Material für Dünnschichtzellen
Einem Forscherteam des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) ist es gelungen, einen vereinfachten Produktionsprozess für Kesterit-Dünnschichtsolarzellen zu entwickeln. Die Absorberschicht der Solarzellen enthält die gut verfügbaren und preiswerten Metalle Zink und Zinn. Die beste Zelle erreicht einen Wirkungsgrad von 10,3 Prozent – ein neuer Bestwert in Europa. „Die neue Verbindung ist dem CIGS sehr ähnlich, enthält aber statt Indium und Gallium die nachhaltig verfügbaren und preiswerten Elemente Zink und Zinn“, berichtet Michael Powalla, Vorstand und Leiter des Geschäftsbereichs Photovoltaik am ZSW.
Das neue Material soll durch ein einfaches Druckverfahren eine günstigere Produktion ermöglichen: Forscher beschichten bei der Herstellung der Kesterit-Solarzellen das Substratglas mit einer nicht-toxischen Tintenlösung. Diese enthält die gewünschten Elemente. „Und das ohne aufwändige Vakuumtechnologie“, sagt Powalla. Die so hergestellte Vorläuferschicht werde anschließend unter Hitzeeinwirkung selenisiert. Die weitere Verarbeitung erfolgt mit den gleichen Verfahren wie bei der verwandten CIGS-Technologie. Für einen kommerziellen Einsatz der Kesterit-Zellen sei es aber noch zu früh, so das ZSW.
Das Stuttgarter Forschungsinstitut kommt damit an den in den USA aufgestellten Weltrekord von 11,1 Prozent heran. Die US-Weltrekordzelle wurde allerdings mit einem aufwändigeren Prozess hergestellt, so die ZSW-Forscher. Ihre Solarzelle habe mit 0,5 Quadratzentimetern die Maße von Standardversuchszellen.
Zudem bestätigte das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE den Wert. Hintergrund: Die Absorberschicht von Solarzellen ist der zentrale Bestandteil der Dunnschichtzellen. Diese nimmt einen Großteil des eingestrahlten Lichts auf und wandelt es in Elektrizität um. Diverse Forschungsaktivitäten zur Optimierung von Solarzellen setzen deshalb hier an.
Rutger Schlatmann
ist seit 2008 Direktor des PVcomB. Zuvor war der gebürtige Niederländer sechs Jahre lang als Entwicklungsmanager bei Helianthos BV.
Die Firma entwickelte Produktionstechnologie für flexible Solarzellen auf der Basis von Siliziumdünnschicht. Helianthos BV war eine Tochterfirma des Chemiekonzerns Akzo Nobel NV, von Shell Solar und Nuon, einer Vattenfall-Tochter. rutger.schlatmann@helmholtz-berlin.de