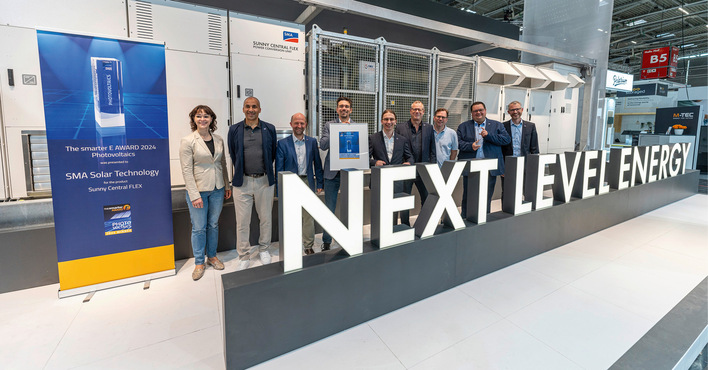Nach den Berichten der Regionalpresse klagt Doll über zu wenig Ladesäulen. Und er klagt über den steigenden Preis, den er für die Beladung der Tesla-Batterie an der Säule zahlen muss. Deshalb macht die E-Taxe miese.
Säulen oft zugeparkt
Doll moniert zudem, dass die Säulen oft zugeparkt sind und ungenutzt bleiben. Wie Doll gegen über der Deutschen Presseagentur bestätigt, „parken die vielen Carsharer die öffentlichen Ladesäulen zu“. Sie abschleppen zu lassen, mündet in einen täglichen Nervenkrieg.
Doll hatte sich den Tesla 2016 gemietet, weil dieses Taxi im Unterhalt günstiger war als ein Auto mit Hybridantrieb. Bis zum Juni 2019 konnte er an den Ladestationen in Berlin zum Pauschalpreis laden. Im Sommer kündigte der Betreiber Allego an, dass künftig nach Kilowattstunden abgerechnet wird – wie vom Gesetzgeber gefordert. Die Folge: Statt zwei Euro zahlt Martin Doll nun elf Euro für 100 Kilometer.
Steigende Preise und wachsende Konkurrenz
Damit nicht genug: Im Juni brachte Volkswagen 1.500 vollelektrische VW-Golf im Carsharing auf die Straßen der Hauptstadt. Damit sind die rund 800 Ladepunkte an 415 Säulen in Berlin faktisch dauerdicht.
Doll will weitermachen, aber mit einem Hybrid. Nun fordern Presse und Opposition mehr Ladesäulen, damit auch E-Taxis eine Chance haben. Aus dem Fall Doll nix gelernt? Was der Fall in Berlin vor allem zeigt: Offenbar bietet die Ladesäule kein Geschäftsmodell für die massenhafte E-Mobilität in Ballungsräumen.
Taxifahrer ohne Hinterland
Denn der Stromverkauf für Autokunden bietet nur dann ein Geschäft, wenn die Kilowattstunde an den Säulen richtig teuer wird – viel teurer als der ohnehin schon happige Strom für private Haushalte. Hätte Doll ein eigenes Grundstück und genug Photovoltaik auf dem Dach, wäre ihm das nicht passiert. Aber: Der Mann ist ja typisch für die Metropole, in der Flächen und Grundstücke rar sind. Er ist Taxifahrer ohne Hinterland.
Nicht der Mangel an Ladesäulen ist das Problem – so viele E-Mobile gibt es ja noch gar nicht. Das Problem ist der teure Ausbau der letzten Meile. Dass die Strompreise an den E-Zapfern steigen, ist dem hohen Investitionsaufwand für die Säulen geschuldet – nicht dem Mangel an Säulen.
Und es ist der Tatsache geschuldet, dass die Verantwortung bei den regionalen Netzbetreibern liegt – einem öffentlichen Monopol. Dass freier Wettbewerb die Ladepreise senken könnte, ist in diesem Betreibermodell schlechthin unmöglich – wie bei der Müllabfuhr oder den Wasserbetrieben.
Das Problem der letzten Meile
Ladesäulen im öffentlichen Raum bilden die letzte Meile zum Kunden. Sie zu errichten, ist sehr teuer: Da muss der Bagger ran bis zur nächsten Stichleitung in der Straße. Da braucht das Stromnetz mehr Saft, um die notwendige Leistung bereitzustellen. Schon heute kracht Berlins Stromnetz aus allen Nähten, laufen die Leitungen heiß.
Die Metropole wird aus unterirdischen Adern mit 750 Kilovolt versorgt. Kommen jetzt noch hunderte oder gar tausende Ladesäulen hinzu, müsste man neue Hochspannungsleitungen bauen, um den Strom in die Stadt zu bringen. Man müsste die Umspannwerke anpassen und so weiter. Das ist richtig teuer.
Ohne Zuschüsse läuft nichts
Dagegen wird an den Säulen nur vergleichsweise wenig Strom getankt. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Errichtung von tausenden Ladesäulen nur mit starken Zuschüssen von Bund und Ländern möglich ist. Für den wirtschaftlichen Betrieb der Ladesäulen inklusive Wartung und Ersatz hat noch niemand ein Konzept.
Um den Netzanschluss von 22 Kilowatt bis 150 Kilowatt zu finanzieren, müsste die Zapfsäule theoretisch rund um die Uhr unter Volllast laufen, um – trotz der hohen Strompreise – noch Gewinn abzuwerfen. Im Fall von Taxifahrer Doll kommt hinzu, dass der Tesla ein schweres Fahrzeug und damit ein Stromfresser ist.
Je kleiner der E-Wagen, desto besser wären seine (wirtschaftlichen) Überlebenschancen im Stadtverkehr. Kleine E-Autos sind aber in der Regel nicht für DC-Ladesäulen mit hohen Leistungen ausgestattet, also braucht der Ladevorgang Zeit. Und je mehr Zeit das Auto braucht, um seine Batterie zu füllen, um so geringer wird die Wirtschaftlichkeit der Ladesäule.
Die Ladesäule ist tot – es lebe die Ladesäule!
Die Ladesäule ist tot – es lebe die Ladesäule! Im privaten, im halböffentlichen und im ländlichen Raum, auf gewerblichen Grundstücken und für gewerbliche Flotten ist sie unverzichtbar, daran besteht kein Zweifel. Doch dort spielt die Refinanzierung über den Stromverkauf nur eine untergeordnete Rolle, kommen andere Geschäftsmodelle hinzu.
Aber in der Großstadt ist die Installation von tausenden Ladesäulen mit ausreichend Power schlichtweg eine Illusion – eine sehr teure Illusion. Wenn die Zahl der E-Mobile in die zehntausende, hunderttausende oder gar Millionen gehen soll, machen die Netze schlapp. So viel Kupfer kann man gar nicht in die Erde bringen, um die erforderliche Ladeleistung anzubieten.
Tausende Battery Spots in den Metropolen
Der einzige Ausweg ist die Wechselbatterie: Millionen E-Autos werden nicht mehr Strom zapfen, sondern an einer E-Tankstelle ihre Batterie tauschen. Ein Roboter hebt die leere Batterie heraus, klinkt die neue Batterie ein – fertig. Der Wechsel dauert fünf Minuten. Die Batterie wird vorm erneuten Beladen geprüft, auf diese Weise ist ein geschlossener Kreislauf für die Lithiumspeicher möglich.
Die Batteriestellen – battery spots, wie die Tankstellen in Zukunft heißen – verfügen über leistungsstarke Ladepunkte, die rund um die Uhr laufen. Denn Beladen des Fahrzeugs und Beladen der Batterien sind zeitlich und räumlich entkoppelt. Und dann kann der Autohersteller entscheiden, ob er seinen Kunden den Batterietausch pauschal anbietet oder nach Kilowattstunden berechnet oder andere Modelle der Finanzierung findet.
Freilich: Ein solches Modell kann nur ein großer Autohersteller in den Markt drücken. Tesla ist dafür viel zu klein. Volkswagen hätte die Macht – und würde sich damit vom Ausbau der Ladeinfrastruktur unabhängig machen. Alle VW-Autohäuser könnten battery spots sein.
Wer auf die Ladesäulen wartet, damit sich Millionen E-Autos rechnen – der wartet bis zum Sankt Nimmerleinstag.