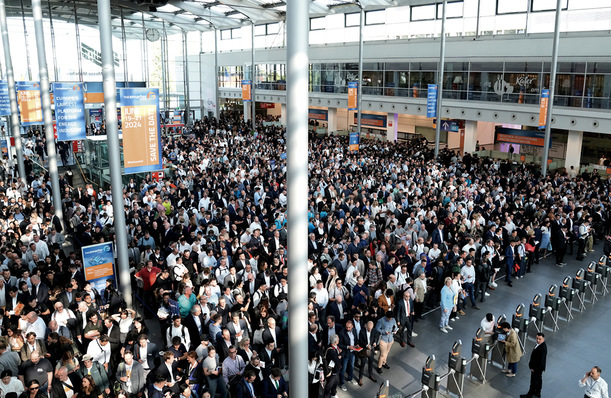Wunsiedel ist eine kleine Stadt im Fichtelgebirge. Nur wenige Kilometer östlich beginnt die Tschechische Republik, und im Norden ist es nicht mehr weit bis zur Grenze nach Thüringen. Die kleine oberfränkische Stadt hat aber Großes vor und einiges schon auf den Weg gebracht. Zu zwei Dritteln fließt Ökostrom durch die Netze der Stadtwerke Wunsiedel. Von den etwa 90 Millionen Kilowattstunden jährlich sind damit schon 60 Millionen erneuerbar.
Zum großen Teil stammt der Strom aus Windkraftanlagen, die auf den Bergen des Fichtelgebirges vor den Toren der Stadt stehen. Im Stadtgebiet selbst stehen aber auch 340 Solaranlagen. Bei einer Bevölkerung von knapp 10.000 Einwohnern ein beachtlicher Wert. Davon betreiben 20 Anlagen die Stadtwerke selbst. Die restlichen 320 Generatoren stehen auf privaten und gewerblichen Gebäuden oder Grundstücken. Dazu kommen noch mehrere Biogasanlagen. Insgesamt sind allein im Netzgebiet der Stadtwerke Wunsiedel Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von über 20 Megawatt installiert.
Der Kunde will Transparenz
Das sind beachtliche Zahlen. Doch die Stadtwerke haben gleich mehrere Probleme. Das erste ist, den produzierten Strom auch an den Kunden zu bringen. Die vielen dezentralen Anlagen stellen die Stadtwerke vor das nächste Problem. Denn deren Betreiber versorgen sich zum Teil selbst mit Strom. Nicht nur, dass die Stadtwerke damit zurechtkommen müssen, dass der restliche Strom ins Netz fließt und der Versorger dies entsprechend steuern muss. Die Selbstverbraucher senken zudem auch den Stromabsatz der Versorger und fallen als Kunden teilweise aus.
Auf der anderen Seite wollen die Stromkunden genau wissen, woher ihr Strom kommt. Ökostrom beziehen ist zwar schön und gut. Aus der Steckdose kommt allerdings Graustrom von der Börse.
Die Situation in der oberfränkischen Kleinstadt ist symptomatisch für den Strommarkt in ganz Deutschland. „Dieser ist ausgerichtet auf die zentralen Großkraftwerke. Doch die Landschaft der Stromerzeugung sieht inzwischen ganz anders aus. In Wirklichkeit haben wir heute 1,6 Millionen Stromerzeuger über die ganze Bundesrepublik verteilt“, sagt Christian Chudoba, Geschäftsführer von Lumenaza.
Das Berliner Unternehmen hat sich aufgemacht, die Probleme der Stadtwerke, aber auch der Energiegenossenschaften und Projektierer zu lösen. Denn auch diese wissen oft nicht, wohin mit ihrem Strom, außer ihn an der Börse zu verramschen. Mit der Lösung der Berliner bekommen die Versorger die Möglichkeit, den regional erzeugten Strom vor Ort zu vermarkten.
Dahinter steckt die Idee, Erzeuger und Verbraucher direkt zusammenzubringen. „Die Stadtwerke haben meist zwar eigene Erzeugungsanlagen, ob fossil oder erneuerbar, aber sie kaufen den größten Teil des Stroms an der Börse und vermarkten ihn dann weiter an ihre Kunden“, erklärt Chudoba. „Dabei haben sie die besten Voraussetzungen, einen eigenen Marktplatz zu kreieren.“
Ähnlich ist die Situation auch bei den Energiegenossenschaften. Diese haben zwar die Anlagen und die Mitglieder, vermarkten aber den Strom zum größten Teil über die Einspeisevergütung. „Es gibt Millionen von Anlagen von klein bis groß, die alle nicht mehr dem Versorger gehören und völlig planlos in das gesamte System eingebunden sind“, erklärt Oliver March, Finanzchef bei Lumenaza. „Wir brechen diese Struktur herunter und balancieren Stromerzeugung und Verbrauch regional aus, sodass der Strom möglichst dort verbraucht wird, wo er auch produziert wird.“
Einen Marktplatz schaffen
Ein Marktplatz für Strom, auf dem Erzeuger und Kunden zusammenkommen, ist das Bild, das sich Christian Chudoba vorgestellt hat, als er die Idee entwickelte. Zusammen mit dem Softwarearchitekten Bernhard Böhmer, der jetzt als technischer Leiter bei Lumenaza arbeitet, hat er eine Kombination aus Steuerungssoftware und Hardware entwickelt.
Unscheinbar sieht die kleine Box aus, die die Anlagenbetreiber in den Schaltschrank installiert bekommen, wenn sie am Marktplatz teilnehmen wollen und keine andere Kommunikationsmöglichkeit haben.
Die Box fungiert als Gateway zwischen der Anlage und der Steuerungssoftware. „Das ist im Wesentlichen ein kleiner Computer, der um ein paar Steuerungsschaltkreise erweitert wurde“, erklärt Chudoba. Lumenaza hat das Gerät selbst entwickelt und lässt es bei Ikoda, einem Hersteller von Leiterplatten, fertigen.
Die Daten vom Gateway fließen dann in die Steuerungssoftware. „Die Kommunikation läuft dabei über ein von uns selbst entwickeltes Protokoll“, erklärt Chudoba. „Dieses kommuniziert in Echtzeit mit minimalem Datenaufwand.“
Alle zwei Sekunden bekommt die Software aktuelle Daten von jeder an den Marktplatz angeschlossenen Anlage. Gleichzeitig nutzt sie die Daten von den Stromkunden. Damit stehen der aktuellen Erzeugung ebenso aktuelle Verbrauchsdaten gegenüber. Die Steuerungssoftware gleicht die beiden Seiten aus.
Auf der einen Seite kann sie ein Signal an das Gateway zurückschicken und die Anlagen auf einen bestimmten Wert herunterregeln. Auf der anderen Seite kann sie aber auch die Geräte beim Kunden steuern. „Bisher liegt die Funktionalität aber zu 90 Prozent auf der Produktionsseite“, sagt Chudoba mit Blick auf die Grenzen bei der Verbrauchssteuerung.
Nur große Verbraucher steuern
Diese würde sich ohnehin auf die großen Verbraucher im Haushalt und in den angeschlossenen Gewerbebetrieben beziehen. In der Regel sind dies Wärmepumpen oder andere elektrische Wärmeerzeuger, die den Strom als Wärme in große Pufferspeicher schicken können. „Es ist nicht nur utopisch, alle kleinen Verbraucher steuern zu wollen“, begründet Chudoba diese Grenzen. „Außerdem sind sie ohnehin von geringer Bedeutung beim Stromverbrauch. Die elektrische Wärmeerzeugung macht in den Haushalten und Unternehmen, die solche Geräte installiert haben, immerhin 80 bis 90 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus.“
Am Ende steht ein kompletter Bilanzkreis mit vielen dezentralen Erzeugern und Verbrauchern. In der Mitte sitzt das Stadtwerk oder die Energiegenossenschaft, die so den regional erzeugten Strom dort vermarktet, wo er produziert wird, und Erzeugung und Verbrauch so steuert, dass idealerweise kein Strom mehr an der Börse zugekauft wird.
Jede Anlage simuliert
Die Herausforderung ist dabei, die Anlagen und Verbräuche so zu steuern, dass beide Kurven ideal aufeinanderpassen. „Wir versuchen, die ganzen Randbedingungen wie Wetterdaten, die installierte Leistung, die hierarchische Bilanzregion, die installierten Speicher, die Flexibilitäten, die Lastverschiebungen und den Eigenverbrauch zu optimieren“, erklärt Technikleiter Bernhard Böhmer. „Wir lassen alle diese Daten in das System einfließen, damit das Stadtwerk oder die Energiegenossenschaft den Bilanzkreis richtig steuern kann.“
Dazu simulieren die Berliner jede einzelne Anlage und optimieren deren Einspeisung mit Blick auf verschiedene Randbedingungen. Diese können individuelle oder netzseitige sein“, betont Chudoba. „Wenn wir eine Anlage aufnehmen, haben wir gewisse Grundparameter wie die Leistung und Ausrichtung sowie die verwendete Technologie, die Verschattungssituation und das Alter der Anlage. Daraus errechnen wir eine Prognose, wie viel Strom die Anlage bei der für diese Region typischen Sonneneinstrahlung produziert. Danach schauen wir uns an, was der Generator tatsächlich an Strom liefert. Die Steuerungssoftware passt dann den gesamten Bilanzkreis entsprechend diesen Daten an.“
Dadurch lernt die Software ständig, wie die tatsächliche Stromproduktion aussieht, und kann über den permanenten Abgleich wiederum immer bessere Prognosen errechnen. „Der größte Unsicherheitsfaktor ist dabei das Wetter“, weiß Chudoba. Denn die Basis des Anlagenbestandes besteht vor allem aus Solargeneratoren und Windrädern.
Das Gesetz der großen Zahl
Die Berliner nutzen für die Steuerung hoch aufgelöste Wetterdaten und Wettervorhersagen. Außerdem lassen sie die Messdaten der vergangenen 20 Tage einfließen. „Wir können aber auch über den Tag hinweg noch einmal eingreifen, wenn die Prognose und die tatsächliche Wettersituation zu weit auseinanderlaufen. So können wir auch noch einmal bei den Anlagen gegensteuern.“
Hier macht sich Lumenaza auch die Kleinteiligkeit der vielen dezentralen Anlagen auf dem Marktplatz zunutze. Ein Problem der großen Direktvermarkter, dass die vielen kleinen Anlagen einen zu hohen Steuerungsaufwand und Probleme bei der Bilanzkreissteuerung verursachen, sieht Chudoba nicht.
Im Gegenteil. Es ist eher so: Je mehr Anlagen beteiligt sind, umso einfacher lassen sich die Fehler herausmitteln. „Letztlich zählt nicht jede einzelne Anlage, sondern der Verbund an Erzeugern. Deshalb sehen wir einen enormen Vorteil, wenn mehr Anlagen im System sind. Denn gemäß dem Gesetz der großen Zahlen wird dann der Fehler insgesamt kleiner.“
So können die Berliner mit den vielen kleinen Anlagen besser eventuelle Abweichungen ausgleichen. „Denn wir sehen die Region als Bündel von Erzeugern und nicht jede einzelne Anlage“, ergänzt Oliver March.
Regionales Stromprodukt vermarkten
Am Ende geht es darum, die Strombörse perspektivisch außen vor zu lassen. „Derzeit sehen wir die Strombörse nur noch als Überlaufventil“, betont Chudoba.
Der Versorger vor Ort bekommt dafür eine immer aktivere Rolle. Er schließt bidirektionale Verträge mit seinen Kunden und motiviert über ein regionales Stromprodukt die Anlagenbetreiber und Stromkunden, sich selbst damit zu identifizieren.
Für die Stadtwerke, Energiegenossenschaften und Projektierer werden so ganz neue Geschäftsmodelle möglich. Das Stadtwerk kann Anlagen auf Dächern von Gewerbekunden bauen. Diese nutzen den auf dem Dach produzierten Strom selbst. Den Reststrom nimmt das Stadtwerk ab und vermarktet ihn direkt in der Region.
Für überregionale Versorger, die nicht so stark vor Ort verankert sind, wird das Modell kaum möglich sein. So bekommen die Stadtwerke ein Alleinstellungsmerkmal. Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes, wirklich regionales Stromprodukt auf den Markt zu bringen und ihren Kunden die vollkommene Transparenz zu bieten.
Schließlich wird auf dem Portal jede Anlage und jeder Anlagenbetreiber vorgestellt, und jeder Kunde kann sich genau anschauen, woher sein Strom kommt. „Damit bekommt der Strom für den Kunden ein Gesicht“, fasst Christian Chudoba zusammen.