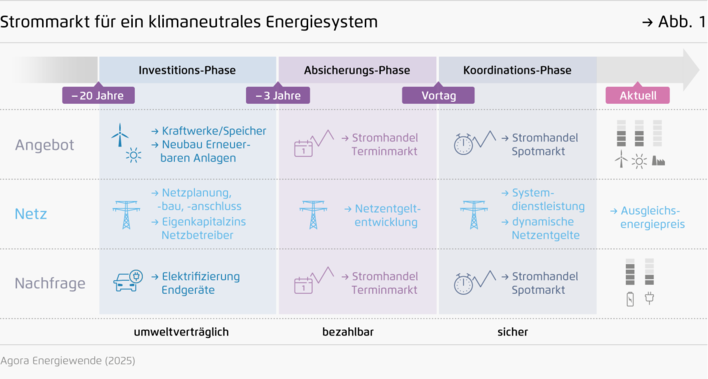Wenn man die Diskussionen über den Ausstieg aus der Kohle verfolgt, muss man vor allem zwei Dinge mitbringen: Geduld und Fantasie. Geduld, weil es um historische Veränderungen geht. So etwas braucht eben Zeit, im Osten wie im Westen. Geduld, weil sich die notwendigen Veränderungen in manchen Köpfen nur sehr langsam vollziehen, quasi durch die Hirnwindungen tropfen, kriechen, sickern. In diesem Sinne ist die politische Kaste im Osten wie im Westen erstaunlich ähnlich gestrickt: Ihre Trägheit beim Kohleausstieg ist das erste wirklich gesamtdeutsche Projekt schlechthin.
Wer bringt die Jobs?
Doch die Geduld hat ein Ende, wird langsam belohnt. Mittlerweile geht es in den Debatten, Interviews und Talkshows nicht mehr darum, ob Ausstieg oder nicht. Sondern um die Modalitäten des Übergangs, neudeutsch: des Strukturwandels. Die Kardinalfrage lautet: Wie gelingt es, den betroffenen Regionen eine wirtschaftliche Zukunft zu geben?
Dabei wird – ebenfalls unisono in Ost und West – vor allem von Jobs gesprochen. Es wird kaum darüber geredet, was mit den gigantischen Gruben geschehen soll, mit den unzähligen Restlöchern, Kanälen, Straßen, Halden, Brachen und Gebäuden, die zur Kohle gehörten. Oder mit den Kraftwerken, die nach der Abschaltung niemand mehr braucht. Wer macht die Sauerei eigentlich weg, und wer zahlt die Zeche?
Die Säure aus den Halden
Die gute Nachricht zuerst: Kohle erzeugt keinen radioaktiven Abfall. Man könnte die Flächen, die gemäß Bergrecht zu sichern sind, problemlos verwerten. Die schlechte Nachricht: Die Abraumhalden stecken voll von Mineralien, die einst hunderte Meter unterm Mutterboden schlummerten. Die besser nicht ans Tageslicht hätten kommen dürfen.
Beispiel Lausitz: Werden die Pumpen abgestellt, laufen die Tagebaue nach und nach voll, steigt das Grundwasser auf. Doch der Abraum enthält giftige Pyrite. Das sind schwefelhaltige Mineralien, die das Wasser versäuern. Deshalb vergiftet der steigende Pegel in den Gruben den Spreewald, das touristische Kleinod in dieser Region. Die saure Suppe tötet alles, was am Ufer und unter der Wasseroberfläche wachsen könnte. Sie hinterlässt braune, leblose Ödnis.
Dennoch schwadronieren die Politiker (lokal, regional, föderal) vom Tourismus und vom Wassersport, wenn die gigantischen Mondkrater eines Tages vollgelaufen sein werden. Was davon zu halten ist, sieht man in der Gegend südlich von Leipzig: Zwar lauert dort weniger Säure in den Halden, enthalten die Böden mehr Kalk, wirken neutralisierend. Zwar sind einige Tagebaue mittlerweile geflutet, bis zum Rand.
Keine Seen in Neuseenland
Doch auch „Neuseenland“ hat eigentlich keine Seen. Sondern gigantische Schüsseln: viel Wasser, aber keine Pflanzen, Lurche oder Fische. Tote Löcher sind das! Das einzige Leben an der Grube ist ein bisschen Wassersport – jawoll! Es gibt ein paar Wassergrundstücke mit Ausblick auf die Böschung gegenüber – jawoll! Tragende Konzepte sehen anders aus.
Manche Politiker schwärmen vom Ausbau des Breitbandgiganetzes, um Startups in die alten Kohlereviere zu locken, eine neue Gründerszene. Carbon Valley ausgerechnet in Düren, Borna oder Lauchhammer? Die jungen Gründer wären längst da, wenn es irgendwie lukrativ wäre. Mit dem Ausbau des Internets hat das nichts zu tun. Niemand geht in die Wüste, der er am Puls der Zeit bleiben will.
Konzepte von gestern
Diese Fantasien sind einfach zu dürftig, zu kleingeistig, viel zu sehr von gestern. Die Kohle hinterlässt gigantische Wüsten, Landschaften wie auf dem Mond. Wer den Strukturwandel gestalten will, muss ein offensives Konzept für diese Flächen haben. Und ein Gespür für die Kompetenz dieser Regionen. Grevenbroich nennt sich selbst „Hauptstadt der Energie“. Auch die Lausitz nennt sich selber gern „Energieregion“. Hat ihre Kohle doch einst die DDR und Berlin versorgt.
Die Zukunft entscheidet sich an den Flächen. Dazu ein paar Zahlen: Allein der Tagebau Nochten in der Lausitz verschlingt 9.000 Hektar. Garzweiler wird 2.300 Hektar verwüsten. Hambach braucht 4.000 Hektar, Jänschwalde in Brandenburg 3.200 Hektar und Inden in NRW rund 4.500 Hektar. Das sind die größten Gruben, von denen einige bis 2050 laufen sollen.
Vier Gigawatt aus Hambach
Wir Solarleute sind es gewöhnt, Flächen in Energie umzurechnen. Über den Daumen gepeilt ergibt der Hektar ein Megawatt Photovoltaikleistung. Macht neun Gigawatt allein in Nochten. Oder 2,3 Gigawatt in Garzweiler. Oder vier Gigawatt in Hambach. Und so weiter. Klar, man kann die Flächen nicht eins zu eins mit Solarmodulen bebauen. Aber hier geht es um die Fantasie, um eine Vision, um den Regionen neue Arbeit zu bringen. Wenn es gelingt, nur ein Fünftel oder ein Zehntel der Flächen mit Solarmodulen zu nutzen, wäre es ein enormer Gewinn – für die Regionen und für die Energiewende.
Und: Die Tagebaue verfügen oft über ausgezeichnete Windverhältnisse, energietechnisch gesprochen. Die Rheinebene die Leipziger Tieflandsbucht und die Lausitzer Streusandbüchse sind flach und unverstellt, der Wind fegt ohne Hindernisse über Gruben und Halden hinweg. Man könnte also relativ leicht Windkraft und Photovoltaik kombinieren, könnte große Hybridkraftwerke errichten. Die Anschlüsse in der Hochspannung sind bereits vorhanden, um die gewaltigen Strommengen ins Netz zu bringen.
Die Fachleute sind schon da
Und vor allem: Die Arbeitskräfte sind schon da. Fachleute, die sich mit elektrischem Strom und den Konversionsflächen auskennen, gibt es genug. Doch von der zuständigen Gewerkschaft hört man nix, nur Gejammer. RWE nutzt jede Chance, die Leute loszuwerden. An der Börse wird der Energiekonzern mittlerweile wie eine Bad Bank gelistet, die Bosse haben andere Sorgen. Vattenfall hat seine Kohlereviere in der Lausitz an tschechische Investoren verkauft, die sich vorher schon die Tagebaue in Mittelsachsen unter den Nagel gerissen haben.
Das sind die Aasgeier, die sich an den Resten laben, das letzte Mark aus den Knochen saugen. Weil weder die Konzerne, noch die Gewerkschaften, noch die Politik ein Konzept haben, eine Vision, eine Idee. So bleiben die Menschen vor Ort allein, warten nur noch auf ihre Entlassung. Werden ihnen Augen und Ohren verkleistert mit Geschwätz von Breitbandinternet und Tourismus.
Die Lösung liegt auf der Hand
Dabei liegt die Lösung förmlich auf der Hand: Die alten Braunkohlereviere für die Energiewende zu nutzen, ihre Flächenpotenziale mit sauberen Generatoren zu veredeln – das schlüge die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Faktisch gibt es keine Alternative, denn anders sind die riesigen Flächen gar nicht nutzbar. Man könnte Solaranlagen und Windräder installieren, und sie in einigen Jahrzehnten ohne Probleme zurückbauen, um die Flächen anderweitig versilbern.
Keine Nachnutzung ist derart kostengünstig zu haben. Ein Gigawatt Solarleistung kostet derzeit rund 800 Millionen Euro. Bisher haben der zaghafte Rückbau und die Flutung der Gruben allein in der Lausitz bereits mehr als 15 Milliarden Euro verschlungen. Mit Sonnenstrom und Windkraft gäbe es ein neues, ein echtes Geschäftsmodell für die gepeinigten Fluren, würde das Wort „Energieregion“ auf neue Weise mit Leben erfüllt.
Man kann es auch so sagen: Die Energiewende braucht die alten Kohlereviere. Und die alten Kohlereviere brauchen eine Zukunft mit sauberer Energie. Die Menschen vor Ort, ihre Erfahrung und ihr Engagement – nie waren sie so wertvoll, wie heute. Was wir jetzt brauchen, ist der politische Wille, den Strukturwandel zu gestalten. Wir haben die Menschen, die Flächen, die Technik. Noch einmal: Die Lösung liegt auf der Hand.