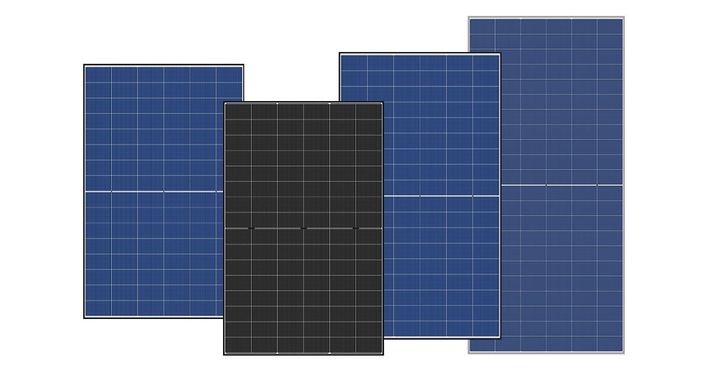Auf der Homepage von Jörg Tappeser kann man noch lesen, wie er sich die Qualitätssicherung der von ihm verkauften Anlagen vorstellt. Nach der elektrischen Messung des Wirkungsgrades sollte ein Wärmebild mit einer Infrarotkamera seinen Kunden zeigen, dass alle Module einwandfrei arbeiten. Im Verkaufsgespräch bietet er diesen Service jedoch nicht mehr an. Tappeser ist von seiner teuer erworbenen Thermografiekamera enttäuscht. „Ich habe mit der Kamera noch keinen Fehler gefunden, der sich auch in der Kennlinie bestätigt hätte“, sagt er. Was er in Fachzeitschriften über Thermografie las, hatte ihn zunächst begeistert. Heiße Stellen, kaputte Zellen und falsche Anschlüsse könne man damit leicht und schnell sichtbar machen, hieß es, und das mit handlichen Kameras schon unter 10.000 Euro. Bei seinen Tests kam er aber entweder nicht dicht genug an die Module heran oder nur so, dass der Winkel viel zu schräg war. „Ich kann mir dafür doch keinen Hubwagen kaufen“, klagt er.
Tatsächlich dürfte es viele Photovoltaikinstallateure geben, die wie Tappeser von der neuen Technik begeistert sind, dabei aber die Komplexität und die Kosten unterschätzen. Denn bisher standen hauptsächlich die Vorteile im Fokus der Berichterstattung. Die Thermografie ist als berührungsfreies Verfahren effizient und schnell, stört den Betrieb nicht und kann Leistungsverluste aufspüren und sichtbar machen (siehe Kasten Seite 91).
Doch erst vor zwei bis drei Jahren ist sie für die Photovoltaik als neues Einsatzgebiet erschlossen worden. Bis dahin diente sie zum Beispiel zur Überprüfung elektrischer Verschaltungen, der Messung von Gebäudedämmungen, als Hilfsmittel in der Medizin und als Nachtsichttechnik.
Erste Forschungen zum Beispiel vom Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern) wiesen 2007 nach, dass mit Hilfe der Wärmebilder auch Fehler in Photovoltaikanlagen aufgespürt werden können. Die Wissenschaftler um Claudia Buerhop-Lutz bauten gezielt Schäden in ein Modul ein und vermaßen sie thermografisch und mit Kennlinien. Sie zeigten, dass viele Fehler eindeutige Wärmemuster aufweisen, und stellten sie in ihrer „Machbarkeitsstudie zur Überprüfung der Qualität von Photovoltaik-Modulen mittels Infrarot-Aufnahmen“ dar. Dieses Handbuch ist, obwohl drei Jahre alt, noch immer fast die einzige Quelle zum Nachschlagen.
Zwar haben Thermografen und Forscher seitdem gewaltige Fortschritte gemacht, doch ihre Erfahrungen zirkulieren nur im kleinen Fachkreis und gelangen erst langsam in die Öffentlichkeit. So sind es vor allem Erfolgsmeldungen, die die Einführung der neuen Methode begleiten. Einhelliger Tenor ist, dass fast immer Fehler entdeckt werden, deren Behebung den Anlagenertrag und die Sicherheit verbessert. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass die Thermografie künftig im Gepäck eines jeden Installateurs zu finden sein wird. Zu speziell und komplex sind die Anforderungen an Technik und Personal und zu hoch die Einstiegskosten.
Teure Ausrüstung
Wenn Stephan Neitzel mit seiner Ausrüstung anrückt, ist jedem klar, hier ist ein Profi am Werk. Je nach Auftrag trifft der Unternehmer aus Ganderkesee mit seinem Hubsteiger oder dem Messfahrzeug mit klimatisiertem Auswertungsraum und 18 Meter hohem Mast ein. Seine neue Infrarotkamera hat mehr als 50.000 Euro gekostet, hat eine Auflösung von 640 mal 480 Messpunkten und wird durch ein Teleobjektiv ergänzt.
Die meisten Kameras messen Licht einer Wellenlänge, das nicht durch Glas dringt. Dadurch kann man mit Thermografie nur Fehler finden, die so viel Hitze entwickeln, dass das Glas erwärmt. Für detaillierte Analysen hat Neitzel deshalb sogar eine gekühlte Kamera aus der Militärtechnik bestellt. Sie misst auch Licht mit kürzeren Wellenlängen, das durch Glasflächen dringt. Das gibt eine bessere Information darüber, wie heiß die unter dem Glas liegenden Strukturen sind.
Mit dieser Ausstattung kann er sich die optimale Perspektive für seine Messungen suchen und große Flächen thermografieren. Ergeben sich Auffälligkeiten, kann er mittels Teleobjektiv oder Hubwagen näher heranrücken und das Modul aus der Nähe inspizieren. „Zu Anfang haben wir zwar Fehler entdeckt, konnten sie aber noch nicht zuordnen“, erzählt er von seinem Einstieg in die Photovoltaikmessung. „Wir haben uns das dann immer wieder angeschaut, bei den Betreibern nachgehakt und nachgemessen.“ Schließlich hätten sich eindeutige Fehlermuster herauskristallisiert. Doch erst die Kennlinienmessungen und die Thermografie zusammen mit einer optischen Inspektion sind für ihn ein unschlagbares Team.
So zeigen sich im Wärmebild manchmal Fehler, die doch keinen oder nur einen geringen Leistungsabfall des Moduls bewirken, zum Beispiel wenn von einer Zelle eine Ecke abgebrochen ist. Dann ist die Kennlinie noch akzeptabel. An anderer Stelle sieht man womöglich mit bloßem Auge schon einen Schmorfleck. Die Leistung mag das kaum beeinflussen, aber die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Auch kurzgeschlossene oder nicht angeschlossene Module fallen auf, das sind Installationsfehler, die sich schnell beheben lassen. Erst alle drei Betrachtungsarten führen somit zur Entscheidung, ob ein Modul ausgetauscht werden müsste.
Inzwischen gibt Neitzel seine Erkenntnisse in Kursen an der Akademie des Deutschen Energieberater-Netzwerkes weiter. Seiner Erfahrung nach machen gerade Anfänger oft den Fehler, ihre Messfleckgröße, also das Auflösungsvermögen der Kamera falsch einzuschätzen und aus zu großem Abstand zu messen.
Auflösungsvermögen beachten
Im Gegensatz zur Digitalfotografie haben die besten ungekühlten Thermografiekameras gerade erst das Megapixel erreicht. Verbreitet ist eine Auflösung von 320 mal 240, mit der man, verteilt über den Bildausschnitt, 76.800 Punkte vermisst. Mit einem Normalobjektiv und bei einem Bildausschnitt von fünf mal vier Metern würde ein Messpunkt vielleicht alle 15 Millimeter gesetzt, bei einer Auflösung von 160 mal 120 dagegen nur alle 32 Millimeter. Das reicht nicht aus, um Fehler zu finden, die nur eine kleine Fläche erwärmen. „Oft weisen die Busse zwischen den Zellen Verbindungsprobleme auf. Die kleinen Lötpunkte sind aber bei zu großer Entfernung nicht mehr sichtbar“, sagt Neitzel.
Doch der Thermograf muss noch mehr beachten. So sollte er sich über den Emissionsgrad seines Messobjektes und die Gefahr von Reflexionen im Klaren sein. Er muss sich einen Standort etwa senkrecht zur Oberfläche suchen, da sonst nicht genügend Wärme in Richtung seines Detektors abstrahlt. Auffälligkeiten zeigen sich zudem erst im oberen Leistungsbereich der Module. „Verdoppelt sich die Intensität der Sonneneinstrahlung, vervierfacht sich die Temperatur am Fehler“, erklärt Neitzel. Das liegt daran, dass die Verlustleistung beispielsweise an schlechten Kontakten nach den Gesetzen der Physik vom Quadrat der Stromstärke abhängt. Bei kristallinen Zellen gilt deshalb eine Einstrahlung von 500 Watt pro Quadratmeter als Minimum. Für Messungen mit Beweiskraft muss somit auch die Strahlungsintensität dokumentiert werden, wofür ein weiteres Messinstrument erforderlich ist.
Irritierend ist für Anfänger auch, dass Module unter blauem Himmel deutlich kühler gemessen werden als unter bewölktem. Das liegt an der reflektierten Wärmestrahlung von den Wolken. Sie hat eine höhere Intensität als die Strahlung des klaren blauen Himmels.
Aufgrund der Komplexität der Infrarotmessung empfiehlt es sich, zunächst einen Grundlagenkurs zu belegen und Erfahrungen mit verschiedenenKameramodellen zu sammeln, bevor man in eigenes Equipment investiert.
Ausbildung nötig
Wer nur seine Anlage überprüfen möchte, sollte sich deshalb an einen Profi wenden. Die Chance, im ersten Versuch selbst gute Aufnahmen zu machen, ist auch mit einer geliehenen hochauflösenden Kamera gering. Bei der Auswahl des Spezialisten kann man sich an Zertifikaten orientieren. Diese gibt es in drei Stufen bei spezialisierten Anbietern wie zum Beispiel bei Sector Cert oder der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung. Ein Thermograf, der einige Zeit selbstständig und qualifiziert gearbeitet hat, ein Seminar besucht, eine Prüfung abgelegt und einen Sehtest absolviert hat, kann ein Zertifikat beispielsweise in der Elektrothermografie vorweisen, denn es gibt noch keinen speziellen Abschluss für Photovoltaik. Versicherer verlangen in der Regel einen Nachweis der Stufe zwei. Pro Level muss der angehende Thermograf mit Seminar- und Prüfungskosten von rund 2.500 Euro rechnen und das Zertifikat regelmäßig erneuern. Danach sollte man sich überlegen, ob man noch spezielles Photovoltaik-Know-how erwirbt. Die Nachfrage nach solchen Photovoltaik-Thermografiekursen ist nach Neitzels Erfahrung groß. „Bei uns ist jeder Kurs ausgebucht“, sagt er.
Mit Beginn des nächsten Jahres nehmen deshalb immer mehr Anbieter solche Seminare ins Programm (siehe Kasten).
Da außerdem ein guter Standort, oft nur mit Hubwagen erreichbar, eine gute Kameraausrüstung und Erfahrung nötig sind, ist eine Thermografievermessung nicht billig und rechnet sich erst bei größeren Anlagen. Denn die Diagnosekosten müssen sich anschließend durch Leistungssteigerungen amortisieren. „Wir werden oft erst bei einem Leistungsabfall von 40 Prozent gerufen“, berichtet Neitzel. „Spätestens dann ist die Finanzierung gefährdet und unser Eingreifen geboten.“ Gerade bei Investorenanlagen auf gemieteten Dächern sieht er aber auch völlig unnötige Fehler. Zum Beispiel ganze Stränge, die nicht laufen, weil sich der Wechselrichter abgeschaltet hat. Beim Häuslebauer und stolzen Besitzer einer kleinen Fünf-Kilowatt-Anlage mag das anders sein. „Wenn jemand seine Anlage liebt, kann das natürlich nicht passieren“, sagt Neitzel.
Gute Trefferquote
Besitzer kleinerer Anlagen müssen sich außerdem vor Schnäppchenangeboten in Acht nehmen. Thermografen, die bisher im Winter die Dämmung von Gebäuden vermessen haben, drängen auf den Photovoltaikmarkt, um ihr Equipment auch im Sommer auszulasten. Doch Fehlinterpretationen können für den Anlagenbesitzer teuer werden. Wenn er auffällige Module abbauen lässt oder sie gar einschickt, ohne den tatsächlichen Leistungsverlust zu kennen, wird ihm der Hersteller womöglich mit einer kostenpflichtigen Kennlinienmessung beweisen, dass doch alles in Ordnung ist. Verschmutzungen, Verschattungen und Reflexionen von warmen Objekten aus der Umgebung können auffällige Wärmebilder produzieren. Ein guter Thermograf erkennt die Unterschiede zwischen dem unregelmäßigen Verlauf eines Vogelkotflecks und einem echten Hotspot.
Die Thermografen sind sich darüber im Klaren, dass das Interesse an der Messmethode wächst. „Betreiber und Eigentümer wollen wissen, ob ihre Anlage optimal läuft.“ Und das völlig zu Recht, meint Claudia Buerhop-Lutz vom ZAE Bayern. Bei sinkenden Einspeisevergütungen müsse der Ertrag optimiert werden. In einem gerade beendeten Forschungsprojekt hatte ihr Team in Kooperation mit einem Ingenieurbüro neuere und ältere Anlagen thermografisch vermessen, danach abgebaut und die Fehler im Labor verifiziert. Dabei nutzten sie zusätzlich hochauflösende Thermografie- und Elektrolumineszenzaufnahmen und Kennlinienmessungen. Es zeigte sich eine gute Trefferquote der Thermografie. Statistische Auswertungen zu Fehlerhäufigkeiten stehen jedoch noch aus. Interessant ist, dass die ZAE- Bayern-Forscher noch immer mit einer Kamera auskommen, die nur eine Auflösung von 160 mal 120 Pixeln hat. Durch die optimale Aufnahmeposition vom Hubwagen könnten sogar 20 bis 40 Module gleichzeitig vermessen werden, sagt Buerhop-Lutz. Zwar lasse sich so kein heißer Lötpunkt finden, doch wesentlich häufiger seien ohnehin ganze defekte Zellen und Substrings.
Wer sich also eine Kamera anschaffen will, muss sich über seine Einsatzziele im Klaren sein. Und er sollte sich fragen, ob er bereit ist, für die Ausbildung und zusätzliche Ausrüstung ebenfalls viel Geld zu investieren. Aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich, dass die Preise für hochwertige Kameramodelle entscheidend sinken werden.
Billige Kameras sind abgespeckt
Bei billigeren Exemplaren werden Bestandteile weggelassen, denen in der Photovoltaik eine gewisse Bedeutung zukommt. So ist ein optischer Sucher wichtig. Denn beim Blick aus Süden im prallen Sonnenschein wird das Display immer schlecht zu erkennen sein. „Sie können fast alles noch in der Nachbearbeitung korrigieren“, sagt Neitzel, „bis auf die Schärfe. Die muss man gleich richtig einstellen.“ Für ein hohes Arbeitstempo schwört er zudem auf Wechselobjektive. Die Objektive enthalten jedoch eine beschichtete Germaniumlinse statt einer Glaslinse, denn Glas würde die Strahlung nicht durchlassen. Gute und teure Objektive zeichnen sich durch größere Linsen aus, die mehr Strahlung durchleiten als kleinere. „Germanium wird an den Rohstoffbörsen wie Gold gehandelt“, erzählt Kay Eckardt, Thermografie-Projektleiter beim Kamerahersteller Infratec. „Es ist auch fast so teuer.“ Deshalb werde bei billigen Modellen am Germanium gespart, wodurch die Empfindlichkeit sinke.
Ein Schwachpunkt könne auch mangelnde Qualität oder die niedrige Auflösung des Detektors sein. Um Temperaturunterschiede korrekt zu messen, muss der Detektor seine Referenztemperatur exakt kennen und das System über eine feinstufige Kalibrierung verfügen. „Eine Kamera, die das nicht hat, können Sie nur als Nachtsichtgerät verwenden“, sagt Eckardt. Er empfiehlt, sich auf Messen verschiedene Kameras anzuschauen und sich vom jeweiligen Hersteller beraten zu lassen.
Immer größer wird auch die Bedeutung der Thermografie in der Modulproduktion. Dort geht es einfacher. Ohne wechselnde und störende Umwelteinflüsse können sich die Hersteller einen Messplatz gestalten und die Module schon vor Auslieferung serienmäßig testen. Ebenso können schon beim Wareneingang auffällige Zellen aussortiert werden. Verschiedene Systeme zur Produktionsüberwachung bieten sogar Hochgeschwindigkeitsaufnahmen an. Damit können zum Beispiel zur Qualitätssicherung Shunts, also Kurzschlüsse in den Zellen, detektiert werden.
Für den Installateursbereich heißt es jedoch, so verlockend die Infrarottechnologie ist, als Standardwartung für kleine Anlagen kommt sie derzeit noch nicht in Frage. Da ist es günstiger, ein gründliches Monitoring und regelmäßige Inspektionen zu kombinieren. Falls massive Probleme auftauchen, kann die Thermografie sie zwar schneller einkreisen, doch ein guter Elektroinstallateur kommt auch mit den herkömmlichen Messungen zum Ziel.