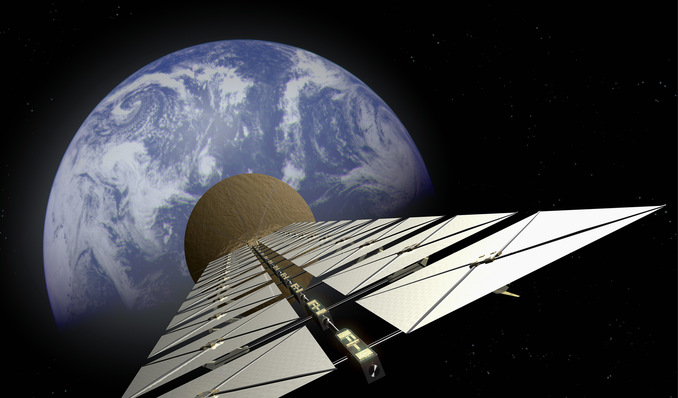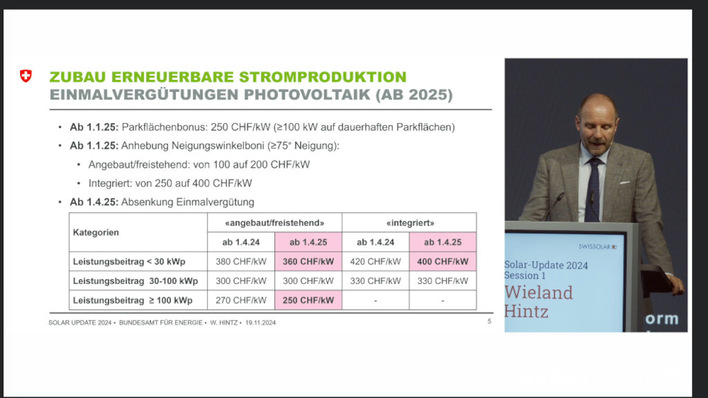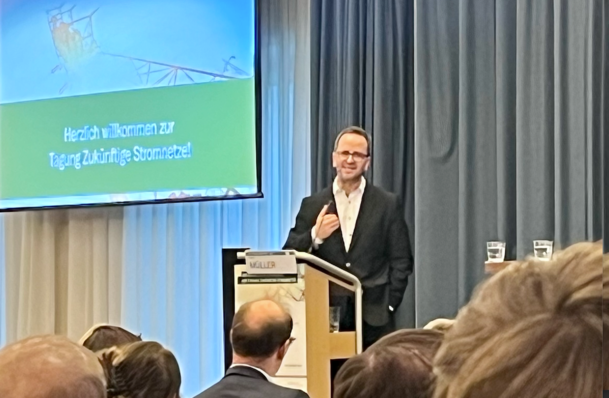Der Standort hat Halbleiter-Tradition. Einst fertigte die Firma ITT Intermetall in diesen Räumen Computerchips, inzwischen hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE die Räume im Freiburger Industriegebiet Nord übernommen. Im Forschungszentrum Simtec – das steht für Silicon Material Technology Research Center – soll die Silizium-Solarzelle weiter optimiert werden.
Statt auf Reinraumtechnik trifft man hier jedoch auf klassische Metallurgie, auf einen Reaktor, in dem große Quarztiegel mit Brocken aus Reinstsilizium verschwinden. Umgeben von einer Schutzatmosphäre aus Argon – Sauerstoff würde sofort mit dem Halbleitermaterial reagieren – wird es zu einer 1.500 Grad heißen Masse eingeschmolzen. Etwa zwei Tage härtet das Halbleitermetall dann zu möglichst gleichmäßig großen Vielfachkristallen aus.Vielfachkristalle, auch poly- oder multikristallines Silizium genannt, sind die meistgenutzten Materialien für Solarzellen. Sie haben zurzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei ist aber klar: Sie sind eigentlich vergleichsweise schlecht geeignet, da sie aus vielen kleinen Kristallen bestehen, in denen die Siliziumatome in absolut regelmäßigen Anordnungen vorliegen. An den Kristallgrenzen, wo die regelmäßige Anordnung unterbrochen ist, rekombinieren in der späteren Solarzelle die vom Sonnenlicht erzeugten Ladungsträger verstärkt. Dadurch geht also Energie verloren. Deshalb ist die Energieausbeute der monokristallinen Zellen, die nur aus einem einzigen homogenen Block bestehen, höher als beim Einsatz von Multikristallen. Das letzte Wort darüber ist aber noch nicht gesprochen. Forscher aus aller Welt arbeiten daran, mit alternativen Herstellungsmethoden noch mehr elektrischen Strom aus dem Silizium herauszuholen.
Denn die Kristallisation des Siliziums ist zwar leicht beschrieben, aber komplex in der Praxis. „Das bringt einige Herausforderungen mit sich“, sagt Stefan Riepe, Teamleiter am Simtec. Denn es gibt verschiedene Risiken: Verschmutzungen des Siliziums können dazu führen, dass die Kristalle zu klein werden. Ein schlechter Wirkungsgrad der späteren Zellen wäre die Folge. Oder es entstehen Spannungen in dem Siliziumblock – was beim Sägen der Wafer zu Rissen führen kann.
Also braucht man zum einen viel Zeit. Der Tiegel wird mit der Schmelze im Inneren des Ofens langsam abgesenkt. Sein unterer Teil gelangt in eine kühlere Zone, wo nun eine Kristallisation von unten nach oben stattfindet. Im Tiegel werden viele kleine Kristalle in der Vertikalen wachsen. Im Idealfall zieht sich am Ende jeder Kristall unverändert im Querschnitt durch den gesamten Siliziumblock. Das heißt: Jeder Wafer, der später in der horizontalen Ebene aus dem Block gesägt wird, soll das gleiche Kristallmuster tragen. Kristallgrenzen in der Schnittebene der Wafer gehen auf Kosten des Wirkungsgrades.
Geduld zahlt sich aus
Solche Verfahren gehen zurück auf den US-Physiker Percy Williams Bridgman, dessen Technik bis heute noch die Basis für die Herstellung von polykristallinen Siliziumblöcken ist. „Wir sprechen von VGF“, sagt Riepe. Das steht für Vertical Gradient Freeze, frei übersetzt: gerichtete Erstarrung.
Einige Tage danach liegt der kristalline Silziumblock auf einer Palette im ISE-Labor im Freiburger Gewerbegebiet. Er ist rund 250 Kilogramm schwer. „Das ist ein Siliziumblock der Generation vier“, erklärt der Wissenschaftler. Dies bedeutet, dass aus ihm später vier mal vier Stücke gesägt werden – auch Ingots genannt – , die dann ihrerseits zu hauchdünnen Wafern weiterverarbeitet werden. Und mit ihnen experimentiert das ISE.
Die Industrie nutze bereits Blöcke der Generation fünf, die dann durch vertikale Schnitte in 25 Ingots gesägt werden, sagt Riepe. Die Generation sechs mit 36 Ingots sei in Entwicklung. Damit werden die Blöcke aber auch immer schwerer – von einer halben Tonne der Serie fünf geht es dann in Richtung einer Tonne. Der Transport wird anspruchsvoller.Gleichwohl ist er das kleinere Problem. „Es sind viele technische Details, die am Ende über die Qualität der Kristalle entscheiden“, sagt der ISE-Forscher. Zum einen wegen der Temperaturen: Silizium wird erst bei 1.410 Grad Celsius flüssig, und das Quarz des Tiegels wird bei diesen Temperaturen auch schon spürbar weich. Also wird es auf der Außenseite des Behälters mit Grafit stabilisiert – was wiederum das Risiko mit sich bringt, dass Kohlenstoff des Grafits über die Gasatmosphäre in die Schmelze gelangt. Eine ständige Spülung des Reaktorvolumens mit Argon soll dies vermeiden.
Eine weitere Herausforderung ist, das erstarrte Silizium aus der Form zu bekommen. „So wie man eine Backform einschmiert, muss der Quarztiegel zuvor mit einer Trennschicht aus Siliziumnitrid bedeckt werden“, sagt Riepe. Doch auch hier ist wieder die Gefahr von Verunreinigungen gegeben, diesmal durch den Stickstoff des Trennmittels. „Es gibt Versuche, durch Magnetfelder am Rand der Schmelze Strömungen zu schaffen, die ein Vermischen der Trennschicht mit der Schmelze verhindern“, sagt der Forscher, „das wäre eine elegante Lösung.“Aber dafür ist noch einige Arbeit nötig. Bislang werden mit dem VGF-Verfahren nur polykristalline Blöcke geschaffen.
Neu: Quasimono-Silizium
„Langfristig könnte es gelingen, auch Einkristalle so zu fertigen“, sagt Riepe. Nämlich mit einem Impfkristall, der sich am Boden des Schmelztiegels befindet und zum Teil aufgeschmolzen wird. Durch gerichtete Erstarrung, die sich an dem Impfkristall ausrichtet, erfolgt dann das quasimonokristalline Wachstum.
Noch schaffen es die Forscher nicht, einen ganzen Block auf diese Weise als Einkristall wachsen zu lassen – vom Rand her wachsen immer wieder die Polykristalle. Doch immerhin ein Teil der Schmelze lässt sich bereits so erkalten, dass einige einkristalline Wafer herausgeschnitten werden können.
Schott meldete im vergangenen November in dieser Richtung erste Erfolge und spricht von „Quasimono“-Material. Es sei gelungen, aus einem klassischen VGF-Verfahren hochwertige Quasi-Einkristall-Wafer herzustellen, teilte das Unternehmen mit. Jeder Block werde am Ende in A-, B- und C-Wafer geschnitten, dennnur ein Teil im Inneren ist wirklich monokristallin. Der Fortschritt, heißt es bei Schott, basiere auf einer neuen Prozessführung sowie einer neuen Ofentechnik. Über den Anteil der Quasimono-Wafer am gesamten Block schweigt Schott sich aus. Nur so viel ist zu erfahren: Die Firma arbeite daran, die Methode zu verfeinern, und schätze „das Potenzial, vollständige Einkristalle herstellen zu können, als hoch ein“.
Doch auch wenn ein solcher Wafer monokristallin ist, so bleibt der Wirkungsgrad der Zelle später dennoch ein wenig hinter den Zellen aus anderen Einkristallen zurück. Der Grund sind häufige Versetzungen innerhalb des VGF-Kristalls, die dieses Verfahren noch mit sich bringt. Schott Solar berichtet von einem Zellwirkungsgrad von 19,9 Prozent auf eigenen Quasimono-Wafern, was einem Abschlag von 0,3 Prozentpunkten gegenüber konventionell gezogenen Einkristallen entspricht.
Auch andere Hersteller arbeiten an Quasimono. JA Solar bietet solche Zellen an, Suntech hat auf der letzten Intersolar bereits ein ganzes Modul aus solchen Zellen präsentiert. Das Unternehmenbewirbt als Vorteil, dass die Anfangsdegradation, durch die monokristalline Zellen in den ersten 1.000 Betriebsstunden bis zu drei Prozent Ertrag einbüßen, bei dem neuen Material nicht auftritt.
Der König unter den Kristallen
Trotzdem sind in den Vorzeigemodulen der meisten Hersteller immer noch Zellen aus monokristallinem Silizium eingebaut. Im Wesentlichen erfolgt die Züchtung von Monokristallen noch nach dem Czochralski-Verfahren. Dieses basiert auf einem Ziehen aus der Schmelze. Darüber hinaus gibt es die Zonenschmelzverfahren, auch Float-Zone-Verfahren genannt. Das Czochralski-Verfahren ist schon fast 100 Jahre alt: Ein Impfkristall wird in die Schmelze getaucht und unter langsamer Drehung emporgezogen – und zwar in dem Tempo, wie der Kristall wächst. Die Kristalle bilden an beiden Enden einen Konus und können bis zu 400 Millimeter Durchmesser erreichen. Ein Hersteller ist Bosch, dessen Monokristalle bis etwa 2,30 Meter lang und 170 Kilogramm schwer sind.
„Theoretisch könnten die Kristalle beliebig lang werden“, sagt ISE-Forscher Riepe. Doch das Problem liegt darin, dassdann stetig flüssiges Silizium in den Tiegel nachgefüllt werden müsste. Dann aber hat man Leitungen, in denen heißes Silizium fließen muss, was bei Stillstand der Anlage zur Zerstörung führt: „Silizium dehnt sich wie Wasser aus, wenn es fest wird“, sagt Riepe – die Leitungen würden platzen wie eingefrorene Rohre.
Ein anderes Problem des Czochralski-Verfahrens ist der Übergang von Sauerstoff aus dem Quarz des Tiegels in die Schmelze – denn auch das mindert die Qualität der Zellen. Daher wird nach Lösungen gesucht. Eine solche könnte eine Beschichtung der Innenflächen des Tiegels sein oder auch die Variante mit einem Magnetfeld, das eine Durchmischung von randständigem Silizium mit der Restschmelze verhindert.
Das wohl eleganteste Verfahren – zumindest in der Theorie – ist das Zonenschmelzen, das bereits in den 1950er Jahren erfunden wurde. Hierbei wird ein Stab aus polykristallinem Silizium, das aus dem Siemens-Prozess stammt, per Hochfrequenzspule an einer Stelle aufgeschmolzen. Die Schmelze bildet einen laminaren Fluss, um dann etwas weiter unten wieder in Form eines Monokristalls zu erstarren. „Das Verfahren schafft die höchste Reinheit“, erklärt Peter Dold, Leiter des Labors für Kristallisationstechnologie am Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik in Halle. Störstoffe wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Metalle sind nachher im Kristall kaum noch enthalten, weil die Verunreinigungen sich in der Schmelzzone anreichern. Sie wandern zum Stabende, das später abgeschnitten wird.
Doch dieser Prozess ist teuer. „Er ist zu teuer, um sich langfristig durchzusetzen“, sagt Matthias Reinecke, Department Manager Crystallization Development der Solarworld Innovations GmbH. Solarworld praktiziert daher in seinem Werk in Hillsboro (Oregon) das Czochralski-Verfahren. Der Fraunhofer-Forscher Dold ergänzt: „Dieser Prozess ist bisher nur bedingt automatisiert, anders als das Czochralski-Verfahren.“ Zudem verläuft der Prozess diskontinuierlich: Pro Charge ist die Menge an Silizium durch den eingesetzten Siliziumstab limitiert. Ferner sind die Anforderungen an die Qualität des Ausgangsmaterials hoch: „Nicht jeder Stab aus Siemens-Silizium ist geeignet“, sagt Dold. Die Stäbe dürfen nicht gebogen sein, müssen rissfrei sein und dürfen auf derOberfläche keine allzu große „Popkornstruktur“ aufweisen. So müsse jeder Stab geprüft werden, ob er tauglich sei.
Ein Vorteil wiederum ist die Möglichkeit der präzisen Dotierung in der Gasphase. Denn das Bor, das als Störatom in das Silizium eingebracht wird, um die elektrische Leitfähigkeit zu verbessern, wird beim Float-Zone-Verfahren kontinuierlich in das gerade flüssige Material eingebracht. Damit lässt sich dann ein Phänomen vermeiden, das beim Ziehen aus der Schmelze stets auftritt: In der Schmelze reichern sich die Dotierstoffe – meistens Bor, mitunter auch Phosphor – an. Dies führt zu einer ungleichen Verteilung der Atome im späteren Kristall.
Poly-Vorherrschaft vor dem Ende?
So kämpfen mehrere Verfahren derzeit um die Vorherrschaft im Markt und wer das Rennen gewinnt, ist längst nicht ausgemacht. Zumal sich die Relationen der verschiedenen Techniken zueinander auch verschieben können.
Ein Beispiel: In der Vergangenheit konnte es attraktiv sein, billigere Wafer zu produzieren und dafür einen geringeren Wirkungsgrad in Kauf zu nehmen. Denn die Zelle hatte an den Gesamtkosten der Anlage einen großen Anteil. Nachdem die Zellenproduktion jedoch massiv billiger geworden ist und damit die relativen Kostenanteile von Rahmen, Gläsern und Installation gestiegen sind, wird es immer wichtiger, die Ausbeute der Zellen zu erhöhen. Denn wo ein immer größerer Kostenblock schlicht flächenproportional ist, muss man aus der Fläche möglichst viel herausholen. „Wir haben daher einen Druck des Marktes auf die Hocheffizienzzellen“, sagt Dold. Die Forschung an neuen Methoden für Monokristalle dürfte also mit Nachdruck weitergehen.