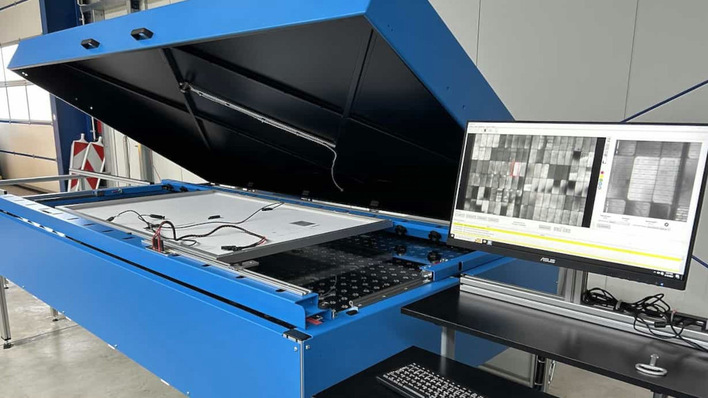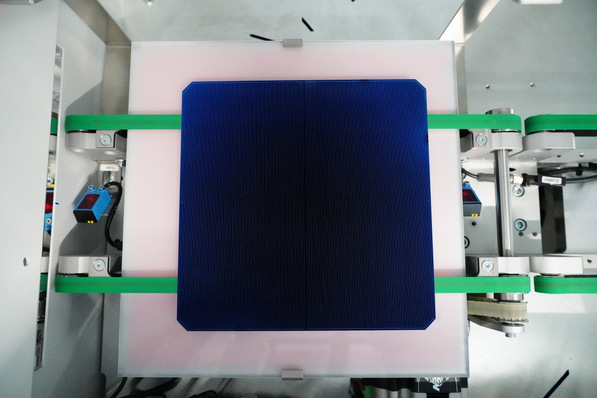Im kenianischen Nairobi hatten sich in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren Firmen niedergelassen, die als Vertreter der großen Photovoltaikhersteller agierten. Sie wollten von der gestiegenen Nachfrage nach Photovoltaik von Seiten internationaler Hilfsorganisationen, die in Nairobi ansässig und in Ostafrika aktiv waren, profitieren. Die Organisationen hatten festgestellt, dass Solarzellen die einzig zuverlässige Energiequelle waren, um Impfstoff-Kühlschränke, Wasserpumpen und andere elektrische Geräte außerhalb der Dörfer und Städte zu betreiben sowie Elektrozäune von Wildtierreservaten mit Strom zu versorgen, um die Wildtiere von den Farmen fernzuhalten. Aufgrund des regen Geschäfts in der Hauptstadt sah sich niemand genötigt, den Komfort der Stadt gegen den Handel auf dem Land einzutauschen. Dabei gab es auf dem Land viele Kenianer, die der Mittelschicht angehörten. Zu ihnen gehörten etwa die Mugambis, die auf dem Land unterrichteten. Sie wünschten sich schon seit Ewigkeiten Strom, hatten die Hoffnung auf einen Anschluss ans Stromversorgungsnetz jedoch bereits aufgegeben. „Wenn wir uns auf die Regierung verlassen müssen, den einzigen Stromversorger in Kenia, werden wir alt und grau“, so Mugambi. Tatsächlich endet der Service von Kenya Power and Lighting praktisch an der Stadtgrenze Nairobis und lässt fast die komplette kenianische Landbevölkerung ohne Stromanschluss dastehen. 1996 hatte man mit dem Elektrifizierungsprogramm des staatlichen Stromversorgers, das 1976 ins Leben gerufen wurde, nur etwa 30.000 der Millionen von Menschen auf dem Land erreicht. „Bei dieser Geschwindigkeit“, so ein Kommentator, „wird es mehr als 800 Jahre dauern, bevor jeder kenianische Haushalt angeschlossen ist.“
Menschen wie die Mugambis wünschen sich strombetriebene Annehmlichkeiten wie Fernsehen und gute Beleuchtung – und sie können es sich leisten. Um in deren Genuss zu kommen, ziehen manche in die Stadt. Andere wiederum, wie etwa der kenianische Beamte Joseph Omokambo, sind nicht weggezogen und können trotzdem fernsehen. Omokambo hatte herausgefunden, dass er auch ohne Anbindung an ein Stromversorgungsnetz den benötigten Strom aus einer Autobatterie ziehen konnte. Je nachdem, wie viel er fernsah, hielt die Batterie bis zu einer Woche. Zum Wiederaufladen musste er sie circa fünf Kilometer weit in die Stadt schleppen und über Nacht bei einem geschäftstüchtigen Stadtbewohner lassen, der ans Stromnetz angeschlossen war und eine improvisierte Ladestation in seiner Garage eingerichtet hatte. Bei seiner Rückkehr am nächsten Morgen zahlte er dem Mann circa zwei Dollar und trug die Batterie nach Hause. Mit der Zeit wurde die Batterie schwächer, und er fuhr immer öfter in die Stadt. Auch wenn es für ihn eine Last war, schleppte er die Batterie weiterhin hin und her. Ansonsten hätte er, wie er glaubte, auf Fernsehen verzichten müssen. Dann erfuhr er von Freunden, dass es eine Möglichkeit gab, die Batterie auch zu Hause zu laden. Solar Shamba, so sagte man ihm, verkaufe ein Gerät, das – auf dem Dach installiert – Strom produziere.
Nähen mit Hilfe der Sonne
Harold Burris, der Gründer von Solar Shamba, war von Beruf Ingenieur. Er war 1977 mit dem Friedenskorps nach Kenia gekommen. Später heiratete er eine kenianische Schneiderin. Als sich seine Frau darüber beklagte, dass ihre fußbetriebene Nähmaschine zu langsam nähte, schloss er diese an einen Gleichstrommotor an, der mit einem Photovoltaikmodul betrieben wurde. Diese Idee, vermutete er, würde nicht nur die Probleme seiner Frau lösen, sondern das Leben vieler kenianischer Frauen verbessern. Trotz eifriger Versuche, das Unternehmen Singer einzubinden und die Idee an Besitzer fußbetriebener Nähmaschinen zu verkaufen, teilte man seinen Enthusiasmus nicht.
1984, etwa zu der Zeit, als Burris sein kleines Solarunternehmen im wohlhabenden Kaffee-Anbaugebiet in der Nähe der Hänge des Mount Kenya aufbaute, entschied ein nahegelegenes Internat auf dem Land, seine Kerosinlampen gegen elektrisches Licht einzutauschen. Die Schulleitung wägte zwei Möglichkeiten ab: Man könnte die Schule ans Netz von Kenya Power and Lighting anschließen oder einen Generator kaufen. Da die Schule 6,5 Kilometer weit vom nächsten Strommast entfernt war, hätte eine Netzanbindung circa 21.000 Dollar gekostet, was deutlich über dem Etat der kleinen Schule lag. Aus diesem Grund entschied man sich für den Dieselgenerator.
Wenige Tage vor dem Kauf schlug Mark Hankins, Friedenskorps-Lehrer für Naturwissenschaften, der Schulleitung vor, Solarenergie in Betracht zu ziehen. Auf den Einwand der Leitung gegen die vermeintlich „teure Lösung“ präsentierte Hankins eine vergleichende wirtschaftliche Analyse, die zeigte, dass ein Photovoltaiksystem günstiger als Diesel sein würde. Die Skepsis blieb, und so schlug Hankins der Leitung einen Besuch von Burris‘ Büro und Wohnung vor, um den Einsatz der Photovoltaik mit eigenen Augen zu sehen. Außer in Verbindung mit dem Lärm und dem Geruch eines Generators hatten die Lehrkräfte vom Land noch nie so viel Licht nach Einbruch der Dunkelheit gesehen.
Solarstrom macht Schule
Die Demonstration an Burris‘ Wohnsitz bewog die Schule dazu, den Kauf des Generators aufzuschieben und stattdessen vier Klassenzimmer testweise mit Solarstrom zu beleuchten, wobei regional hergestellte Batterien und Lampen zum Einsatz kamen. Lediglich die Module wurden importiert. Drei Monate später war das System bereits im Einsatz. Die Augen der Schüler tränten nicht mehr wie früher vom Qualm der Kerosinlampen und wurden nicht durch schwache Beleuchtung überanstrengt. Die Schüler mussten sich nicht mehr wie Motten um das Licht herum versammeln, um lesen zu können. Der Versuch lief derart erfolgreich, dass die Schulleitung den Kauf eines Generators verwarf und Labor, Verwaltungsbüro, die übrigen Klassenzimmer sowie alle vier Lehrerunterkünfte mit Solarmodulen ausstattete. Nachdem andere Lehrer, die zu Besuch kamen, die gute Beleuchtung der Schule gesehen hatten, verlangten auch sie Solarstrom für ihre Schulen. Nächtliche Passanten bemerkten den Unterschied, und die Neugierigen unter ihnen blieben stehen, um mehr über die neue Technologie zu erfahren.
Der Solarstromgenerator von Burris machte von sich reden. Menschen vom Land mit gutem Einkommen – erfolgreiche Landwirte, Beamte, Ärzte, Lehrer und andere Fachleute – besuchten sein Geschäft, um in den Genuss einer bequemen Stromversorgung für Fernseher, Radio, Kassettenspieler und Licht zu kommen. Burris spürte, welche Richtung der Markt einschlug, und passte seinen Kurs an, um die Nachfrage zu bedienen. Er entwarf ein 35-Watt-Solarmodulsystem für Haushalte, das den Strombedarf der Menschen abdecken würde. Von der U.S. Agency for International Development (USAID) mit kleinen Projektzuschüssen unterstützt, bildeten Burris und Hankins ein Dutzend Elektriker aus der Region in der Installation von Photovoltaikanlagen aus. Im Anschluss arbeiteten die Elektriker für Burris. In weniger als fünf Jahren hatte Solar Shamba mehr als 500 Haushalte elektrifiziert, die meisten davon im Bezirk Meru, wo der amerikanische Ingenieur lebte.
Burris schickte seine Techniker zum Kauf der Module nach Nairobi. Nachdem sie wussten, wo die Module erhältlich waren, und unter seiner Anleitung einige Systeme installiert hatten, fassten viele von ihnen den Mut, sich selbstständig zu machen. Als die Verkäufe stiegen, wandten sich auch die Photovoltaikverkäufer mit Sitz in Nairobi an Privathaushalte und stiegen aggressiv in den Verkauf ein. Gegenwärtig gibt es in Kenia Dutzende Unternehmen, die in fast jeder Stadt Solarsysteme für Haushalte anbieten. Die Photovoltaik ist während der letzten sieben Jahre zu einem Millionen-Dollar-Geschäft mit jährlichen Umsatzsteigerungen von 25 bis 30 Prozent angewachsen.
Der Markt wird von einem sehr kleinen Modul dominiert. Mit nur zwölf Watt und einem Preis von circa 80 US- Dollar ist es für viele Kenianer erschwinglich. Seit 1994 wurden jedes Jahr mehr als 10.000 Zwölf-Watt-Einheiten verkauft. Das Mini-Modul-Set wird zusammen mit Fernsehern und Radios vertrieben, denn „die Ladenbesitzer haben erkannt, dass die Menschen beim Kauf eines Fernsehers auch eine Stromquelle zum Betrieb benötigen“, beobachtete Mark Hankins, der immer noch an der Spitze der Photovoltaikszene in Kenia steht. Er hat festgestellt, dass die meisten Käufer kleiner Systeme „aus der Erfahrung lernen, dass solch eine winzige Energiequelle zum Fernsehen und für die Beleuchtung rund um die Uhr ausreicht. Sie lernen, sich den Stromverbrauch einzuteilen.“
Zwei Drittel der Photovoltaiksysteme in kenianischen Haushalten funktionieren, wie es sein sollte. Weitere 13 Prozent funktionieren teilweise – der Fernseher läuft, aber nicht alle Lichter gehen an. Zieht man in Betracht, dass in der Hauptstadt des Landes die Ampeln teilweise monatelang am Stück ausfallen und dass es in der Zentralbibliothek ratsam ist, eine Taschenlampe mitzuführen, weil das Licht nicht immer funktioniert, scheint die Erfolgsbilanz der Photovoltaik vorbildlich. Das ist besonders eindrucksvoll, wenn man die vielen Ad-hoc-Installationen in sehr abgelegenen Gebieten bedenkt.
Nach der Befragung einiger Haushalte, die bereits erfolgreich Solarstrom einsetzten, befand Richard Acker, der eine Solar-Umfrage für die Princeton University durchführte: „Diese Menschen, die den Großteil der Photovoltaiknutzer ausmachen, sind begeistert, weil sie den Annehmlichkeiten, die moderne Technologie verspricht, einen großen Schritt näher gekommen sind. Jetzt verfügen sie über eine zuverlässige Stromquelle. Sie alle jedoch sind in einer Sache unzufrieden: Sie würden alle gern mehr Strom aus ihren Modulen herausbekommen, insbesondere in der Regenzeit.“
Langfristig rentabel
Nachbarn von Photovoltaiknutzern gaben fast einstimmig an, dass sie auch Solarmodule kaufen würden, wenn sie könnten, auch wenn sie womöglich die anfänglichen Vorbehalte von Mrs. Mugambi teilten: „Als mein Mann zuerst mit der Idee kam, ein Photovoltaiksystem anzuschaffen, hielt ich es für zu teuer, weil es das Dreifache unserer beiden Löhne zusammen kostete.“ Nach der Berechnung der Beträge, die sie für Kerosin beziehungsweise Batterien oder Akkus ausgaben, kamen viele Kenianer zu demselben Schluss wie die Mugambis. Sie hatten „bereits ziemlich viel Geld für Energie ausgegeben“, und der Kauf eines Photovoltaiksystems war eine gute Investition.
Von den geschätzten 400.000 Solar-Inselanlagen weltweit befinden sich 60.000 in Kenia. Mit einem Bevölkerungsanteil von zwei Prozent, der bei der Stromversorgung auf Solarenergie zurückgreift, ist Kenia das erste Land, in dem mehr Menschen Sonnenenergie nutzen als das nationale Stromversorgungsprogramm. Noch erstaunlicher ist, dass die Vorherrschaft der Photovoltaik ohne Zutun der Regierung zustande gekommen ist. Die Erfahrungen in Kenia zeigen, dass die Hauptstromquelle in ländlichen Regionen Afrikas die Photovoltaik sein wird.
Solarpioniere mit Mut zum Risiko
Während der kenianische Solarstrommarkt weiter expandiert, hält sich die Begeisterung vieler Konsumenten in Grenzen, wenn sie für das System einen Pauschalbetrag bezahlen müssen. Dadurch ist die Größe eines erschwinglichen Systems begrenzt. Eine Vorauszahlung zwingt die Menschen, Strom für die nächsten 30 Jahre auf einmal zu bezahlen. Richard Hansen, ein amerikanischer Ingenieur und MBA, der sich für die Photovoltaik in der Dominikanischen Republik einsetzt, ist nicht der Einzige, der die Finanzierung als Haupthindernis für eine breite Akzeptanz der Technik ansieht.
Obwohl er für Westinghouse arbeitete, lag Hansens wahres Interesse in erneuerbaren Energien. Am Worcester Polytechnic Institute hatte er Windenergie studiert. Bei Urlaubsreisen durch die dominikanische Landschaft sann er über die Möglichkeit nach, seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf kleiner Windmühlen auf der Insel zu verdienen, da in den ländlichen Gebieten niemand in die Infrastruktur konventioneller Energie investiert hatte und die Menschen mehr Energie brauchten.
Als der Wunsch, auf eigene Faust loszulegen, stärker als das Bedürfnis nach Sicherheit wurde, kündigte Hansen seine Arbeit. Als Maschinenbau-Ingenieur zog er Windmühlen der Photovoltaik vor und gestand, gegenüber einem Gerät, „das nur dasteht und Sonnenlicht in Strom umwandelt“, eine gewisse Abneigung zu verspüren. Schnell musste Hansen jedoch feststellen, dass der Wind nur an wenigen Orten der Dominikanischen Republik regelmäßig weht, während die Sonne praktisch auf der ganzen Insel mit derselben Intensität scheint. Außerdem bemerkte er, dass die Mechanik der Windmühlen, die er liebte, eine Schwachstelle hatte, da bewegliche Teile leicht ausfielen. Die Photovoltaik, so Hansen, „kam ohne bewegliche Teile aus und war daher nicht dem Verschleiß ausgesetzt“. Zwar schmerzte es ihn, sich von den Windmühlen zu trennen, seine Untersuchungen hatten ihn jedoch überzeugt, dass Solarzellen den dominikanischen Haushalten „viel größeres Potenzial“ boten.
Hansen untersuchte dann die Energiekonsum-Gewohnheiten der ländlichen Bevölkerung und fand heraus, dass die meisten Dominikaner die Nachrichten hörten, also Radios hatten, und dass viele Musik liebten, also Kassetten abspielten. Ein einfaches Photovoltaiksystem könnte diese Geräte problemlos mit Strom versorgen, vermutete er. Zu Demonstrationszwecken richtete er in dem Haus, das er gemietet hatte, ein Solarsystem ein. Am Sonntag, dem Tag, an dem Dominikaner sich traditionell mit Freunden treffen, staunten seine Gäste darüber, dass er Fernseher, Radio und Licht mit Sonnenenergie betrieb. Viele waren am Kauf des Systems interessiert, jedoch keiner hatte genügend Geld, es komplett zu bezahlen. Da Hansen selbst nur über beschränkte Geldmittel verfügte, konnte er erst einmal nur ein System auf Kredit verkaufen. Als ersten Kunden wählte er die Familie Martinez, die einen Markt in einer belebten Gegend besaß. „Die Leute würden kommen und das System im Einsatz sehen“, erinnerte sich Hansen. „Die Familie war sehr freundlich und erwies sich aufgrund ihrer kontaktfreudigen Art als sehr werbewirksam. Im Ergebnis beflügelte sie das Geschäft.“
Wieder zurück in den Vereinigten Staaten erhielt Hansen einen dringenden Brief aus der Dominikanischen Republik. Mit dem System war alles in Ordnung. Es lief, so schrieb Martinez, „genau so, wie du es uns beschrieben hast, Richard“. Das Problem war, dass „viele auf deine Rückkehr warten, um über den Kauf dieser Solarsysteme zu verhandeln“.
Die Familie Martinez konnte die Raten pünktlich zurückzahlen, was Hansen davon überzeugte, dass die Dominikaner in der Lage waren, Solarsysteme zu bezahlen – vorausgesetzt, die Kosten würden auf ein paar Jahre verteilt. Mit Finanzierung „würden sich viele die Technologie leisten können“.
Bei seiner Rückkehr in die Dominikanische Republik traf Hansen seine potenziellen Kunden. Zusammen gründeten sie die „Dominikanischen Familien für Solarenergie“, die auf die Idee eines Umlauffonds kamen. Dessen Startkapital sollte den Kredit für eine Start-Installation bilden. Das von den Kreditnehmern gezahlte Geld wurde dann für weitere Solarsysteme eingesetzt. Durch einen USAID-Zuschuss in Höhe von 2.000 Dollar konnten fünf Mitglieder der „Dominikanischen Familien für Solarenergie“ ihre Haushalte im März 1985 mit Solarenergie ausstatten. Jede Familie zahlte 50 Dollar an sowie monatliche Raten von jeweils acht Dollar. Das Geld wurde eingesetzt, um für eine sechste Familie im Juni ein Photovoltaiksystem anzuschaffen.
Das Geld des Umlauffonds war zwar besser als nichts, Hansen und seinen dominikanischen Kunden waren aber die Grenzen deutlich. Mit dem USAID-Startkapital konnten in fünf Jahren lediglich 20 Haushalte elektrifiziert werden. Selbst bei einer Aufstockung des Betrags auf 100.000 Dollar wären es im selben Zeitraum bloß 800 Haushalte. Einer von Hansens Mitarbeitern klagte: „Die Kreditnachfrage für Solarstrom übersteigt die Größe des Fonds bei weitem.“ Man erreicht einen Punkt, an dem „aufgrund von Geldmangel nichts mehr installiert werden kann“, so der Präsident des ländlichen Solarverbands.
Knackpunkt Anzahlung
Also entwickelte Hansen eine neue Herangehensweise. Er sah, dass es deutlich mehr Kunden geben würde, wenn keine Anzahlung zu zahlen wäre. Er wusste durch eine Marktstudie, dass sich womöglich 50 Prozent derjenigen, die keinen Stromanschluss hatten, für die Photovoltaik entscheiden würden, wenn sie nur eine monatliche Rate in Höhe ihrer gegenwärtigen Energiekosten zahlen müssten – und wenn die Wartung garantiert wäre. Eine Möglichkeit zur Senkung der Einstiegskosten sah Hansen darin, einen Photovoltaikservice anstelle des Systems selbst zu verkaufen. So müsste der Kunde das Sachkapital nicht mehr selbst anschaffen und pflegen, sondern ein Solarunternehmen könnte investieren und für den zuverlässigen Solarstrom eine monatliche Gebühr verlangen.
Um einen besseren Einblick zu erhalten, wie Investoren solch eine Wende von einer Energiequelle zu einer anderen erfolgreich vollziehen können, fuhr Hansen zurück in seine Heimat in Massachusetts. Dort untersuchte er, mit welcher Strategie die Stromversorger zur letzten Jahrhundertwende Kunden dazu gebracht hatten, von Gas auf elektrische Beleuchtung umzusteigen. 1993 sahen sich Hansen und seine Kollegen bereit, eine ähnliche Strategie in der Dominikanischen Republik umzusetzen. Hansens Unternehmen Soluz „installiert die Module und schließt das Haus an, die Beleuchtung inbegriffen. Die Kunden erhalten für eine monatliche Rate vollen Service. Wir tauschen durchgebrannte Glühbirnen und verbrauchte Batterien aus. Genau das taten damals die Stromunternehmen“, so Hansen. „Man verschenkte Lampen und schloss die Häuser kostenlos an. Auf diese Weise wechselten die Leute vom Gas zum Strom.“ Und genauso wechseln die Menschen in der Dominikanischen Republik und in Honduras von Batterien und Kerosin zu Sonnenenergie.
Das Solar-Versorgungskonzept zahlte sich für Verbraucher und Investoren aus. „Die Verbraucher behalten ihr Kapital“ und gehen somit kein Risiko ein, erklärte Hansen. „Da ihnen die Ausrüstung nicht gehört, hören sie einfach auf zu zahlen, wenn der Service nicht gut funktioniert. Daher zweifeln sie auch nicht daran, dass wir sicherstellen werden, dass alles läuft.“ Umgekehrt kümmern sich die Kunden, die das System mieten, in der Regel gut darum, weil die Firma einfach die Stromzufuhr beenden kann. „Niemand will den Service wieder verlieren, wenn erst mal elektrisches Licht da war und die Abhängigkeit von Trockenzellen gemindert wurde“, so Hansen. „Wir erhalten entweder die Zahlung oder wir holen uns die Einheit zurück.“ Zusätzlich können sich Investoren auf eine hervorragende Rendite freuen, wodurch mehr Expansionskapital angezogen wird.
Soluz Dominicana, die Tochtergesellschaft von Soluz in der Dominikanischen Republik, ist seit 1994 im Geschäft. Seitdem hat sie mehr als 2.000 Haushalte mit Photovoltaik ausgestattet. Das Unternehmen erreicht, wenn es auf neue Gemeinden zugeht, zwischen 50 und 90 Prozent der Einwohner. Durch die große Anzahl an Photovoltaiknutzern sind der Gebühreneinzug und die Instandhaltung einfacher. Ausgebildete Techniker müssen keine weiten Wege mehr zurücklegen, um weit verstreute Einheiten zu erreichen, wie dies früher der Fall war. „Vorher haben wir nur die Sahne abgeschöpft – das Geld- und Kreditgeschäft“, erinnert sich Hansen. „Wir mussten viel umherfahren, um Kunden mit den nötigen finanziellen Mitteln zu finden. Jetzt versorgen wir so gut wie jeden. Das führt auch zu mehr Wirtschaftlichkeit.“
Unbemerktes Wachstum
Soluz plante, bis 2000 etwa 20.000 Kunden ins Netzwerk aufzunehmen bei einem Potenzial von 50.000 bis 100.000 Kunden über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das Solar-Versorgungskonzept „hat einen stärkeren Einfluss auf Erschwinglichkeit und Marktdurchdringung der Photovoltaiktechnologie als eine gewaltige 50-prozentige Kostensenkung von Zellen bewirken könnte“.
Den Landbewohnern in Entwicklungsländern Kredite mit vernünftigen Raten anzubieten könnte auch die bisher nicht mit Strom versorgte Masse von Menschen in die Lage versetzen, ihre Haushalte durch Photovoltaik zu versorgen. Die Solar Electric Light Company (SELCO) ist ein Unternehmen, das sich mit der Finanzierungsproblematik auf diese Weise auseinandersetzt.
SELCO war die Idee von Neville Williams, der während seiner Arbeit beim Energieministerium zum ersten Mal von Photovoltaik erfuhr. Damals war James Carter Präsident. Der Rückgang der Ölpreise und sein Interesse an Solarenergie während der Amtszeit von Ronald Reagan kosteten Williams seinen Job. Nach jahrelanger Arbeit auf anderen Gebieten fragte er sich schließlich, was aus der Solarenergie geworden sei. Um seine Neugierde zu stillen, arbeitete er in den späten 1980ern bei Solarex als Berater. „Ich war fasziniert von dem, was ich vorfand“, erinnerte sich Williams. Die Photovoltaik hatte nicht nur überlebt, „sie wuchs auf der ganzen Welt, auch wenn es niemand bemerkte. Die Weltbank war total ahnungslos. Die Hilfswerke der Vereinten Nationen hatten keinen blassen Schimmer.“ Williams dachte über seine mögliche Rolle bei dieser stillen Revolution nach.
Ein gut geplanter Traum
Während einer Afrikareise im Jahr 1990 erwachte er eines Morgens mit der Antwort. „Ich werde eine Organistion zur weltweiten Förderung der Photovoltaik aufbauen.“ Seine neue Berufung führte ihn zu Richard Hansen (das war in der Zeit vor Soluz). Was Hansen mit einem Hungerlohn erreicht hatte, zeigte Williams das Potenzial eines gut geplanten Traums auf. Daraufhin kehrte Williams in die Vereinigten Staaten zurück und gründete eine Non-Profit-Organisation, die er Solar Electric Light Fund (SELF) nannte. Durch Spendenaktionen und Stiftungsgelder brachte er eine beträchtliche Geldsumme auf. SELF hielt sich eng an Hansens Konzept: Liefere gute Ausrüstung, biete Instandhaltung, entwickle einen Tilgungsplan und regele den Gebühreneinzug. Im weiteren Verlauf bewies SELF, dass die Menschen in den Entwicklungsländern sehr wohl Geld haben und bereit sind, es für eine bessere Energiequelle auszugeben – wenn Finanzierung geboten wird. Nach dem Start von ländlichen Elektrifizierungsprogrammen in elf Ländern musste Williams erkennen, dass der Bedarf an Photovoltaik den Kreditrahmen, den die Stiftungen bieten konnten, sprengte. Wie Hansen vor ihm sah er nun die Grenzen einer Non-Profit-Organisation.
Vorbild Automobil
Trotz der Einschränkungen, mit denen Williams konfrontiert war, war SELF inzwischen glaubwürdig genug, um Persönlichkeiten wie Harish Hande aus Indien anzuziehen. Hande arbeitete gerade an seiner Doktorarbeit zum Thema Solartechnik an der University of Massachusetts, als er das SELF-Büro in Washington betrat. Die beiden Männer einigten sich darauf, dass SELF zwar bewiesen hatte, dass ein großes Interesse an Solarsystemen für Privathaushalte bestand, Installationen im nennenswerten Umfang jedoch nur mit privatem Kapital finanziert werden könnten. Daher beschlossen sie, ein Privatunternehmen zu gründen, und zwar die Solar Electric Light Company, SELCO.
Hande und Williams nahmen sich beim Aufbau ihres Photovoltaik-Start-ups die US-Automobilindustrie zum Vorbild. Der große Erfolg des Automobils beruhte auf Serviceverfügbarkeit und Finanzierung durch Dritte. Es ist unwahrscheinlich, dass die Massen sich auf die Straßen gewagt hätten, wenn es keine Mechaniker und Ersatzteile für ihre Neuwagen gegeben hätte. Hande und Williams waren überzeugt, dass dasselbe auf die Photovoltaik zutraf. Sie richteten mehrere Solar-Servicezentren im relativ wohlhabenden Südindien ein, wo es Bedarf an Energie gab. Von dort aus sollten Verkauf, die Koordination der Installationen, die Bereitstellung von Modulen, Lichtern und benötigtem Zubehör sowie Reparaturen geregelt werden. Hande und Williams stellten auch fest, dass die Autohändler nicht viele Autos verkauft hätten, hätte man von den Kunden gleich die Zahlung des Gesamtpreises verlangt. Wie konnte man in den Entwicklungsländern erwarten, dass viele Landwirte ein Photovoltaiksystem ohne Finanzierung kaufen würden? Um Kreditmöglichkeiten zu schaffen, mussten sie zunächst die Banker mit ihrem Produkt beeindrucken. Zu diesem Zweck stattete SELCO einige Filialen mit Photovoltaik aus. Während eine unstete Stromversorgung den Betrieb einer Bank erschwert, bietet die stetige Energie der Sonne den Computern an den Schaltern tagsüber durchgehend Strom und ermöglicht nachts eine ausreichende Beleuchtung. „Wenn sie sehen, dass Photovoltaik funktioniert und mit Krediten finanzierbar ist, werden sie die Photovoltaik mit auf die Liste der zu finanzierenden Produkte setzen“, so Williams.
Steigender Wert
Die Bereitschaft der Weltbank, jetzt beträchtliche Geldmittel für die Finanzierung von Solar-Inselanlagen bereitzustellen, ließ Williams‘ Hoffnungen wachsen, andere Teile der Welt mit Solarstrom zu versorgen. Nach seiner Einschätzung „gibt es unbegrenzt viele Kunden, wenn es erschwinglich ist, bei ausreichend niedrigen monatlichen Ratenzahlungen“. Als Beweis schloss SELCO eine Vereinbarung mit Vietnam zur Elektrifizierung einer Million Haushalte innerhalb des nächsten Jahrzehnts ab. Das Unternehmen hoffte, seine Dienstleistungen in diesem Zeitraum weltweit auf drei Millionen Haushalte zu erweitern.
Nichts zeigt den Wert, den man Solarzellen in den Entwicklungsländern beimisst, wohl besser als der starke Anstieg von Solarmodul-Diebstählen während der vergangenen Jahre. „Die Menschen stehlen die Module, weil jeder ihren Wert kennt und um die einfache Anwendung weiß“, kommentierte Guy Oliver. „Entweder werden die Module wiederverkauft, oder der Dieb verbindet sie mit seiner Batterie oder direkt mit seinem Fernseher, Radio oder Kassettenspieler. Und das funktioniert!“, fügte der französische Ingenieur hinzu.
Bei einem Vorfall von Solardiebstahl klopfte der Dieb an die Tür eines britischen Auswanderers, der eine recht umfangreiche Installation von 40-Watt-Modulen hatte. Mit vorgehaltener Pistole musste der Engländer hilflos zusehen, wie mehrere Komplizen mit Bolzenschneidern und Brechstangen die Module abmontierten. Bei einem anderen Vorfall wunderte sich ein Telekommunikations-Unternehmer, weshalb sein kürzlich installiertes System den Dienst versagte. Eine Überprüfung ergab, dass 100 Module gestohlen worden waren!
Bevor der Markt für Inselsysteme explodierte, baute man lediglich einen Zaun um Photovoltaikinstallationen herum, damit das Vieh nicht zu den Modulen gelangen und diese beschädigen konnte. Inzwischen verwendet man zusätzlich Rasiermesserdraht, um Diebe abzuhalten.
johnperlin@physics.ucsb.edu
Das nächste Kapitel handelt von der Verbreitung der Photovoltaik in den Industriestaaten.