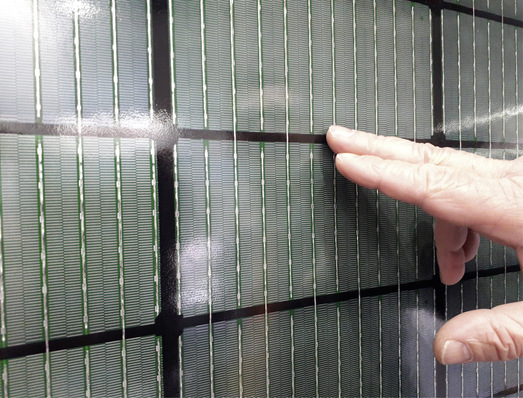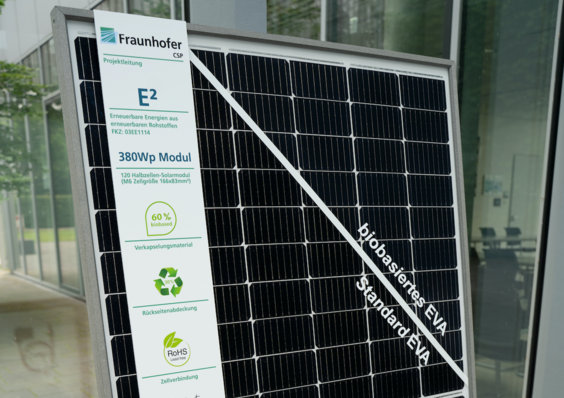Alan Heeger und Alan MacDiarmid von der University of Pennsylvania trauten Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ihren Augen nicht. Eigentlich wollten sie einen neuen Kunststoff herstellen. Doch das Material, das sie nach ihrem misslungenen Experiment auf dem Labortisch fanden, sah stattdessen aus wie ein Metall: silbrig und glänzend. Dreckeffekt nennen die Wissenschaftler so etwas, wenn zufällige Verunreinigungen ihre Versuche beeinflussen. Heute, mehr als 30 Jahre später, erzeugen Physiker rund um den Globus ähnliche Materialien ganz gezielt. „Das Forschungsgebiet explodiert zurzeit“, sagt Konstantinos Fostiropoulos vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, dem früheren Hahn-Meitner-Institut. Bis zu 360 Millionen Euro steckt Deutschland bis zum Jahr 2012 in Projekte zur Entwicklung dieser Solarzellen aus Plastik. 60 Millionen davon stammen aus dem Staatssäckel des Bundesforschungsministeriums, die restlichen 300 Millionen hat die Industrie in Aussicht gestellt.
Eine Laborkuriosität zu viel
Dabei hatten Heeger und MacDiarmid ihr Experiment eigentlich schon als Laborkuriosität abgeschrieben, als sie eher zufällig Hideki Shirakawa von der Universität von Tsukuba in der Kaffeepause eines Kongresses von diesem seltsamen Fund berichteten. Der Japaner hatte 1974 einen ähnlichen Versuch gemacht: Shirakawa wollte Acetylen mit Hilfe eines Katalysators zum festen Kunststoff Polyacetylen verbinden. Statt des normalerweise bei solchen Reaktionen entstehenden schwarzen Pulvers war auch hier das Endprodukt von einem silbrig glänzenden Film überzogen. Zweimal in den USA und einmal in Japan die gleiche Laborkuriosität zu finden, das ist für einen Naturwissenschaftler mindestens einmal zuviel.
Chemiker wissen, dass die silbrige Farbe des Metalls von relativ leicht beweglichen Elektronen herrührt. Ein Teil dieser kleinen negativ geladenen Elementarteilchen ist fest an die Atome des Materials gebunden. Ein anderer Teil ist wichtig, damit die Atome untereinander Bindungen einge hen können. Ein dritter Teil kann sich in manchen Materialien relativ frei bewegen. Er ist dafür verantwortlich, dass Metalle elektrischen Strom im Normalfall gut leiten. Obwohl die silbrige Farbe des Polyacetylens ein Indiz für solche beweglichen Atome ist, konnten Heeger und MacDiarmid erstaunlicherweise keinen Strom durch das von ihnen entdeckte Material leiten. Genau deshalb ist es für den Bau von Solarzellen prädestiniert.
Ein Blick auf die Struktur von Polyacetylen erklärt das Phänomen. Diese organische Substanz, die durch den Dreckeffekt entstanden ist, ist ein Polymer mit konjugierten Doppelbindungen. So nennen Chemiker lange Ketten von Kohlenstoff-Atomen, bei denen die Atome durch Elektronen verknüpft sind. Neben diesen Bindungselektronen gibt es in den konjugierten Polymeren noch weitere Elektronen, die nicht an einzelne Atome gebunden sind, sondern sich über das gesamte Molekül verteilen. Sie erzeugen den silbrigen Glanz, in dem Material, in dem viele Polymerketten wie Spaghetti miteinander verknäuelt liegen.
Allerdings können diese beweglichen Elektronen in einem konjugierten Polymer nicht von einem Molekül zum nächs ten springen. Anders als in einem Metall verteilen sie sich nicht über das ganze Material, sondern nur auf einer Polymerkette. Deshalb leiten solche Kunststoffe als Ganzes keinen Strom. Erst als die Forscher ihren Kunststoff mit den Halogenen Fluor, Chlor oder Brom behandelten, begann er, Strom zu leiten. Die Stromleitung wird durch die zusätzlichen Atome, die Elektronen anziehen, hervorgerufen und ist trotzdem tausendmal schwächer als zum Beispiel in den Kupferleitungen herkömmlicher Stromkabel. Das macht den so modifizierten Kunststoff dem Material ähnlich, das Photovoltaikfreunden wohl bekannt ist: Silizium. Heeger und MacDiarmid hatten einen organischen Halbleiter entdeckt.
Kein Experte war deshalb sonderlich überrascht, als sie und Hideki Shirakawa im Jahr 2000 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurden. Längst zeich neten sich da bereits praktische Anwendungen der silbrigen Polymere ab. Im Juli 2001 ist Alan Heeger dann auch einer der Gründer der US-Firma Konarka, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die von ihm entdeckten Halbleiter-Kunststoffe eingesetzt werden können, um Licht in elektrischen Strom umzuwandeln.
Die späteren Nobelpreisträger erkannten das größte Problem dabei bereits in den 1970er Jahren. Die silbrige Farbe ihrer Kunststoffe rührte ja daher, dass Licht den beweglichen Elektronen die Energie zuführt, die sie zu stärkerer Bewegung anregt. Doch eine Solarzelle lässt sich daraus nur bauen, wenn es gelingt, ihre Bewegung dazu zu nutzen, sie über eine Elektrode zu einer Leitung zu transportieren. Wie in einer Batterie hätte man dann einen Pol mit einem Elektronenüberschuss. Den anderen Pol bildet der Kunststoff. Dort fehlen dann die Elektro nen und hinterlassen Löcher und einen Überschuss an positiver Ladung.
Was in der Theorie nach einem einfach durchführbaren Prinzip aussieht, ist in der Praxis mit vielen Hindernissen und Fußangeln gespickt. Die Kunst besteht darin, die Löcher und die angeregten Elektronen sehr schnell abzuführen. Viel Zeit bleibt den Forschern dazu nämlich nicht. „Exziton“ nennen Chemiker dieses Elektron-Loch-Paar im gleichen Molekül. Es überlebt nicht lange. Die Elektronen verlieren innerhalb von Sekundenbruchteilen ihre Energie und werden wieder eingefangen, da sich positive und negative Ladungen anziehen.
Die Möglichkeit zu einer effektiven Ladungstrennung bot sich erst, als Fostiropoulos 1990 zum ersten Mal eine andere neu entdeckte Verbindung in einem Lichtbogen in größerem Maßstab herstellte. „Wenn sie einen Kohlenstoffdampf im Plasma herstellen und dann plötzlich abkühlen, dann reagieren die Atome miteinander und organisieren sich selber“, sagt er. Und zwar zu den Molekülen, die Wissenschaftler Mitte der 1980er Jahre entdeckt hatten. Sie hatten herausgefunden, dass sich 60 oder mehr Kohlenstoff-Atome zur Form eines submikroskopischen Fußballs verbinden lassen, den so genannten Fullerenen. Diese molekularen Bälle aber sind nicht nur extrem stabil, sondern entpuppen sich auch als wahre Elektronensauger. Tatsächlich schaffen es solche Fullerene problemlos, Elektronen herauszuholen, nachdem diese durch Licht angeregt wurden.
Mit dieser Entdeckung rückte die Möglichkeit sehr viel näher, aus organischen Halbleitern Solarzellen herzustellen. Längst existiert auch schon ein europäisches Netzwerk dazu. In OrgaPV.net haben sich 22 Gruppen aus staatlicher und industrieller Forschung zusammengeschlossen. Denn auch auf der Ebene der Europäischen Union tut sich einiges, bis zum Jahr 2009 will die EU eine Roadmap haben, die den Weg zur organischen Solarzelle im Alltag vorzeichnet.
„Mit den Forschungsgeldern soll zum Beispiel der immer noch sehr niedrige Wirkungsgrad verbessert werden“, erklärt Vladimir Dyakonov, der an der Würzburger Universität Experimentalphysik lehrt und an genau diesen Polymer-Fulleren-Solarzellen forscht.
Das Elektron, das die Lichtenergie aufnimmt, wandert allenfalls zehn oder 15 Nanometer (Millionstel Millimeter) durch die Polymerschicht. Soll der Elektronensauger Fulleren also wirksam werden, darf er höchstens diese zehn oder 15 Nanometer von der Stelle entfernt sein, an der ein Elektron-Loch-Paar entsteht.
Elektronen springen nur kurz
Um eine solche geringe Entfernung zu erreichen, gibt es verschiedene Methoden. Vladimir Dyakonov setzt dabei auf eine gute Vermischung der beiden Ausgangssubstanzen in einer Flüssigkeit: Zunächst gibt er das konjugierte Polymer und das Fulleren unabhängig voneinander jeweils in ein organisches Lösungsmittel, wie zum Beispiel Chlorbenzol, und rührt es über Nacht. Danach vermischt er beide Lösungen in einem bestimmten Verhältnis miteinander und bringt die Mischung auf einen so genannten „Spincoater“ auf. Das ist ein kleiner rotierender Teller, auf dem sich der Tropfen zu einer dünnen Schicht verteilt, bevor der Rest der Flüssigkeit nach außen wegfliegt. So entsteht eine dünne Schicht, in der Polymer und Fulleren gut miteinander vermischt sind.
Bei einer anderen Methode entstehen solche Schichten durch Auftropfen auf ein Substrat, über dem eine Art mikroskopischer Rasierklinge den Flüssigkeitstropfen zu einer extrem dünnen Schicht ausstreicht. Besonders attraktiv ist die dritte Methode, bei der die Mischung mit einem Gerät aufgebracht wird, das einem Tintenstrahldrucker ähnelt – diese Solarzellen können also gedruckt und damit recht preiswert hergestellt werden.
Farbstoffe statt Kunststoffe
Doch noch effektiver könnte ein komplett anderer Ansatz werden: Helmholtz-Forscher Fostiropoulos arbeitet bei der Herstellung seiner Solarzellen nicht mit Lösungsmitteln, sondern verdampft die benötigten Substanzen im Hochvakuum. Anschließend lässt er sie zu dünnen Schichten auf einem Substrat wieder kondensieren. Der Vorteil dieser Methode sind die fast beliebig dünnen Schichten, die damit aufgedampft werden können. „Damit können wir auch die Moleküle in beliebigen Verhältnissen mischen und so die optimale Zusammensetzung suchen“, erklärt der Physiker weiter. Bei der Lösungsmittelmethode geht das viel schlechter.
Allerdings würden die von Vladimir Dyakonov verwendeten Polymere erst bei so hohen Temperaturen verdampfen, dass sie sich gleichzeitig zersetzen würden. Fostiropoulos verwendet daher Phthalocyanine genannte Farbstoffe, die dem Chlorophyll ähneln, mit dem Pflanzen Sonnenlicht auffangen. Diese Farbstoffe werden längst von der chemischen Industrie relativ preiswert hergestellt. Da sie viele leicht bewegliche Elektronen enthalten, erzeugt Sonnenlicht in ihnen ebenfalls Elektron-Loch-Paare. Vor allem aber bleiben die Phthalocyanine auch noch bei 500 Grad Celsius stabil. In seiner Beschichtungsanlage dampft Konstantinos Fostiropoulos diese Phthalocyanine als so dünne Schichten auf, dass darin entstehende Elektron-Loch-Paare problemlos den Weg zur benachbarten Fulleren-Schicht schaffen. Denn anders als in Dyakonovs Polymer-Solarzelle liegen die das Sonnenlicht absorbierenden Moleküle und die Elektronensauger nicht vermischt in einer Schicht vor, sondern fein säuberlich getrennt. Noch kürzer und damit effektiver als in solchen flachen Schichten aber wäre der Weg für die Elektron-Loch-Paare, wenn man kammartige Strukturen aufdampft. Dann hätten die Elektron-Loch-Paare nicht nur oben und unten Fullerene in erreichbarer Nähe, sondern auch rechts und links.
Solche Strukturen könnte man leicht erreichen, wenn man die Kämme bereits im Substrat vorgäbe, auf dem die Schichten aufgedampft werden. „Diese Schichten mit Kämmen im Zehn-Nanometer-Bereich herzustellen ist aber sehr teuer und scheidet als Methode zur Herstellung billiger Solarzellen daher aus“, erklärt Fostiropoulos. Er experimentiert daher zurzeit mit speziellen Aufdampftechniken, die in selbstorganisierten Prozessen eine Art Teppich aus Nano-Grashalmen wachsen lassen. Wenn er es schafft, die richtige Dicke für diese Grashalme einzustellen, könnte so eine Solarzelle entstehen, in der die meisten Elektron-Loch-Paare ihre Elektronen an Fullerene abgeben und die daher einen deutlich besseren Wirkungsgrad als bisher haben.
Kontaktierung nötig
Ein anderer Grund für die noch relativ niedrigen Wirkungsgrade der organischen Solarzellen liegt in der Kontaktierung. „Die Elektronen können von Fulleren zu Fulleren hüpfen, während die positiven Löcher im Polymer wandern“, erklärt Vladimir Dyakonov. Nun müssen zwei Elektroden angelegt werden, von denen die eine die Elektronen und die andere die positiv geladenen Löcher absaugt. Insbesondere die Herstellung der Elektrode auf der Vorderseite der Zelle ist nicht trivial, da sie ja transparent sein muss, um das Sonnenlicht durchzulassen, das die Elektronen-Loch-Paare erzeugt. Bisher nimmt man dazu meist Indiumzinnoxid (im Englischen als ITO für Indium-Tin-Oxyde abgekürzt), das immerhin rund 90 Prozent des sichtbaren Lichtes durchlässt. „Allerdings ist Indium relativ teuer, so dass bereits mit Zinkoxid als alternativer Anode experimentiert wird“, sagt Fostiropoulos. Bei diesem Zinkoxid aber müssen sowohl die Lichtdurchlässigkeit wie auch die „Elektronensaugeigenschaften“ noch verbessert werden – auch hier will das Forschungsministerium die bewilligten Gelder einsetzen.
Die organischen Solarzellen sollen durch das Forschungsprogramm so gut werden, dass sie etwa in Mobiltelefonen, PDAs und Autos eingesetzt werden können. Mobile Anwendungen stehen also im Vordergrund. Das liegt daran, dass die Haltbarkeit der organischen Solarzellen noch zu wünschen übrig lässt. In dem Forschungsprogramm ist anvisiert, dass sie bei zehn Prozent Wirkungsgrad zwei bis drei Jahre halten. Länger nicht.
Problem Haltbarkeit
Schuld daran ist der Sauerstoff, der allgegenwärtig ist und Elektronen noch deutlich besser anzieht als die Fullerene. Sobald die neuen Solarzellen daher mit Luft oder auch nur geringen Mengen Feuchtigkeit in Berührung kommen, funktionieren sie einfach nicht mehr, weil der Sauerstoff alle Elektronen wegfängt. Deshalb waren die ersten Prototypen organischer Solarzellen auch nicht lange haltbar. Um die Lebensdauer zu erhöhen, müssen Luft und Sauerstoff möglichst gut von den Solarzellen ferngehalten werden. „Das könnte man natürlich mit einfachen Glasscheiben erreichen“, erklärt Dyakonov, der neben seinem Lehrstuhl demnächst auch noch Chef des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung in Würzburg, Erlangen und Garching sein wird. Dann aber wären die Solarzellen nicht mehr flexibel und ein großer Vorteil gegenüber den kristallinen Siliziumzellen ginge verloren. Daher arbeiten die Forscher und Firmen mit Folien, die dauerhaft Sauerstoff ausschließen können. Solche Solarzellen blieben dauerhaft flexibel und könnten dann in Zelte und sogar Kleidung integriert werden.
Die Experten versprechen sich von den organischen Zellen noch einen weiteren Vorteil. Nicht nur die Materialien, sondern auch die Produktion soll billiger sein als bei kristallinen Siliziumzellen. Sowohl die Drucktechnik als auch die Verdampfungstechnik bergen das Potenzial, in einem kontinuierlich laufenden Prozess hergestellt zu werden. In diese so genannte Rolle-zu-Rolle-Technik setzt die Industrie große Hoffnung, da sie billiger ist als eine Technik, bei der immer ein Werkstück eingelegt, bearbeitet und wieder ausgeschleust werden muss, wie es bei der Bearbeitung der Siliziumwafer der Fall ist.
Die beiden Dresdener Fraunhofer-Institute für Photonische Mikrosysteme und für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik bauen deshalb eine so genannte „Rolle-zu-Rolle-Vakuumbeschichtungsanlage“, die nicht nur für die Herstellung organischer Photozellen, sondern auch für organische Leuchtdioden verwendet werden soll. Diese Leuchtdioden funktionieren ähnlich wie die Photozellen, aber in umgekehrter Richtung, wenn sie elektrischen Strom in Licht wandeln. „Erste OLED-Demonstratoren aus dieser neuen Anlage werden für Anfang 2009 erwartet“, sagt IPMS-Chef Karl Leo, der ebenfalls aus dem 360 Millionen Euro schweren deutschen Fördertopf Unterstützung erhält.
Produktion läuft an
Dass die großen Investitionen gerechtfertigt sind, zeigte der Entdecker der leitenden Kunststoffe im Juli 2007. Alan Heeger präsentierte gemeinsam mit dem Koreaner Kwanghee Lee eine Solarzelle mit einer Kombination aus konjugierten Polymeren und Fullerenen, die im Labor satte 6,5 Prozent Wirkungsgrad hat, also 6,5 Prozent der auftreffenden Sonnenenergie in Strom umwandelt. Das ist zwar noch ein ganzes Stück weit von den herkömmlichen Silizium-Solarzellen entfernt, die als Monokristalle bis über 20 Prozent Wirkungsgrad haben, ist aber im Prinzip erheblich billiger. Langfristig sollten Kosten von 20 bis 30 Cent pro Watt möglich sein. Wenn alles klappt, wird Ende dieses Jahres bei Konarka sogar die Produktion der ersten Solarzellen nach diesem Prinzip anlaufen, der Preis dürfte aber erst einmal natürlich deutlich höher liegen.
Variieren die Forscher die Zusammensetzung der Komponenten, sollten sich auch beim Wirkungsgrad noch weitere Verbesserungen erreichen lassen. Vladimir Dyakonov von der Universität Würzburg erwartet in den kommenden Jahren daher, dass die anvisierten Wirkungsgrade bis zu zehn Prozent Realität werden. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Experten aus der Industrie jetzt neue Absatzmärkte für ihre Produkte wittern und die 300 Millionen Euro locker machen wollen, um die Investitionen des Forschungsministeriums aufzustocken. Wenn Solarzellen aus Kunststoff konkurrenzfähig werden, bedeutet das für Kunststoffhersteller nämlich eine Chance auf neue, große Absatzmärkte.