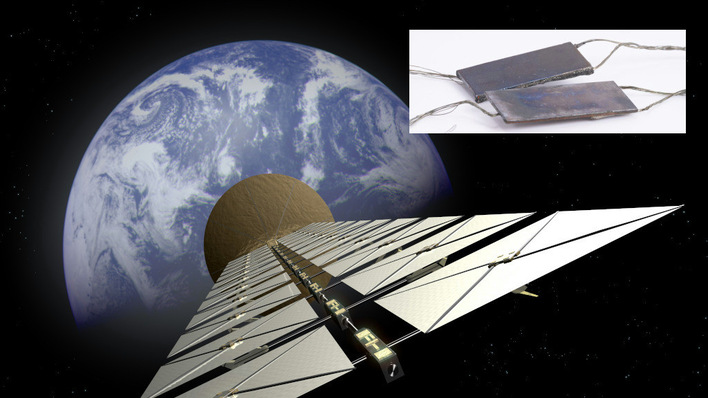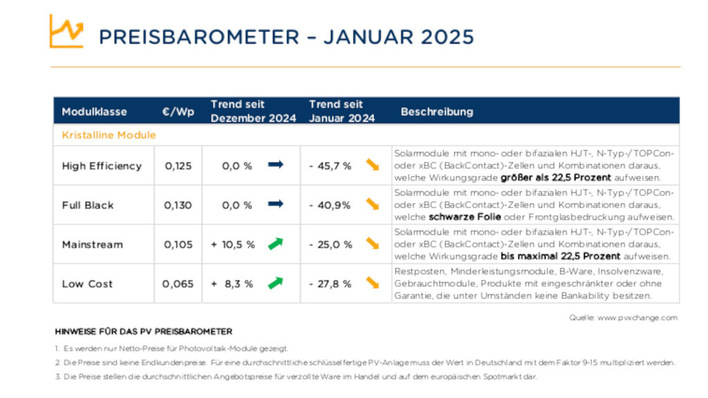Heimlich, still und leise: In der neuen Fabrik von Odersun in Fürstenwalde geht es zu, als seien die Heinzelmännchen am Werk. Keine Autostunde östlich von Berlin surren schmale Kupferbänder fast geräuschlos von der Rolle. Einen Moment später verschwinden sie im galvanischen Bad, wo sie erst hauchfein mit Indium und dann im nächsten Schritt mit Schwefel beschichtet werden. Alle drei Elemente bilden zusammen den Halbleiter, der im fertigen Modul Licht in Strom umsetzt. Außerdem geben sie den CIS-Modulen ihren Namen: Das C aus dem Cu für Kupfer, I für Indium und S für Schwefel. S kann auch für Selen stehen – chemisch gesprochen Se –, das einige Hersteller alternativ oder in Ergänzung zum Schwefel verwenden. Wenn noch Gallium dazukommt, wird die Formel einfach auf CIGS erweitert.
CIS- und CIGS-Module haben geringere Wirkungsgrade als Module aus Silizium, aber dafür wird auch nur eine hauchfeine photoaktive Schicht benötigt. Sie wird im Vakuum gesputtert oder im galvanischen Bad aufgetragen – die Hersteller haben unterschiedliche Verfahren entwickelt, den photoaktiven Film auf Glas oder Metall als Träger aufzutragen. Gemeinsam ist allen der Versuch, Energie zu sparen und den Verbrauch von Chemikalien einzugrenzen, um die Kosten zu drücken und die Umwelt zu entlasten.
Ungewöhnlicher Modulaufbau
In Fürstenwalde fuhr Odersun Anfang 2010 nach einer jahrelangen Probephase der Pilotlinie die automatisierte Massenfertigung „Sun Two“ an. Jetzt schlängeln sich die knapp einen Zentimeter breiten Kupferstreifen durch vier parallel arbeitende Produktionslinien. In einer Halle läuft die Beschichtung der Bänder, sprich: die Fertigung der Zellen. Nebenan wird das Modul komplettiert: Hier finden die Verlötung der Strings, Verglasung, Laminieren und der abschließende Modultest statt. Odersun hat die Prozesstechnik weitgehend selbst entwickelt. Das Ziel: die Herstellung kundenspezifischer Solarmodule, variabel in Größe und Form. Dafür werden die beschichteten Kupferbänder miteinander zu einer Superzelle verschaltet und auf in der Branche gebräuchliche PET-Folien geklebt. Sie isolieren die Elektronik und sollen Witterungsbeständigkeit garantieren. Dabei galt es, die Herstellungskosten durch einen möglichst geringen Aufwand niedrig zu halten.
Damit die Nachhaltigkeit dabei nicht auf der Strecke bleibt, wurden „die Aspekte des Umweltschutzes von Anfang an in die Planung der Fertigung einbezogen“, sagt Olaf Tober, Technikchef bei Odersun. Das betrifft nicht nur die Fertigung, sondern auch die Arbeitsumgebung: Die Fabrikgebäude werden unabhängig vom öffentlichen Wärmenetz über ein integriertes Wärme- und Kühlsystem versorgt, das die Abwärme der Maschinen nutzt. „Die Dächer sind bereits für die Ausstattung mit Solaranlagen vorbereitet“, sagt Tober. Hauseigene Module sollen bald auf den Werkshallen installiert werden.
Bei der Herstellung der Module profitiert Odersun von seinem ungewöhnlichen Modulaufbau. Die meisten Hersteller tragen die Halbleiterschichten auf eine Glasscheibe auf, die erst mit Molybdän und dann mit Kupfer besputtert wird. Odersun spart sich diese beiden Schritte und lässt die schmalen Kupferstreifen auf einer Seite durch die Galvanikbäder laufen – mit Glasplatten von der Größe eines Standardmoduls wäre das unmöglich.
Umweltfaktor Energie
„Wir können weitgehend auf das energieaufwändige Sputtern im Vakuum verzichten“, erklärt Olaf Tober. „Die Halbleiterschichten werden unter anderem elektrolytisch oder über Sprayprozesse aufgetragen.“ Einzige Ausnahme ist der Vakuumschritt, bei dem der transparente Frontkontakt auf die obere Glasscheibe gesputtert wird. In Fürstenwalde wird der Kupfer zunächst elektrochemisch gereinigt und geätzt, danach mit Indium beschichtet. „Anders als beim Sputtern oder bei der Verdampfung nutzen wir das Indium im basischen Elektrolyt 100-prozentig aus“, sagt Tober. Im Galvanikbad wird das Indium nur dort abgeschieden, wo es benötigt wird, also auf dem Kupferband und nicht an den Wänden der Vakuumkammern.
Eigentlich fällt der Zellfertigungsprozess unter das Bundesimmissionsschutzgesetz, aber bei Odersun sind die Emissionen und Abfälle so gering, dass für das neue Werk eine Genehmigung nach dem Baurecht ausreichte. Natürlich brauchen die galvanischen Prozesse trotzdem Chemikalien. Reststoffe wie die Kupfer- und Indiumschlämme werden fachgerecht entsorgt. Wo es geht, setzt Odersun auf die Wiederverwertung. „Die Ingenieure haben die Prozesse so angelegt, dass diese optimal ausgenutzt werden und möglichst geringe Reste bleiben“, sagt Tober. Das Elektrolyt aus den Galvanikbädern läuft in einem Kreislauf und kann durch Aufbereitung mehrere Monate lang wiederverwendet werden. Mit konkreten Zahlen, ob und wie viele Kosten die Umwelttechnologie zukünftig einsparen wird, ist Odersun vorerst zurückhaltend. „Da uns Vergleichswerte fehlen und wir uns zudem erst am Produktionsanlauf befinden, können wir noch keine Abschätzung geben“, sagt Korinna Penndorf, Pressesprecherin von Odersun. Mit seinen Kupferbändern, die gleichzeitig Substrat und Teil der photoaktiven Schicht sind, ist Odersun jedenfalls ein Exot unter den Herstellern von CIS- und CIGS-Modulen. Die meisten Hersteller verwenden ein Rückglas mit Molybdänschicht.
Eigene Wege
So auch Avancis. Auch hier setzt man auf Technologie, die im eigenen Haus entwickelt wurde, und versucht vor allem, Energie und Chemikalien einzusparen.
Die Wurzeln des Unternehmens liegen in den 90er Jahren in Kalifornien. Darauf aufbauend, gründeten Shell und Saint-Gobain im Jahr 2006 das gemeinsame Unternehmen Avancis. 2008 fuhr in Torgau an der Elbe eine 20-Megawatt-Linie an, und der Ausbau um 80 Megawatt ist bereits geplant. Um die Versorgung mit Glas brauchen sich die Torgauer keine Sorgen zu machen. Avancis bezieht von der Mutterfirma Saint-Gobain seine vorgefertigten Gläser. Das Molybdän fungiert als Rückkontakt des Moduls und garantiert eine gute Haftung des CIGS-Halbleiters. Siliziumnitrid verhindert den unkontrollierten Übergang von Natrium aus dem Glas in den Halbleiter. 20 Quadratmeter groß sind die beschichteten Glasscheiben, bevor sie auf Modulgröße zugeschnitten werden. Avancis strukturiert die Molybdänelektrode mit einem Laser zunächst in 104 Einzelzellen. Anschließend wird Kupfer als 200 Nanometer dicke Schicht aufgebracht. Das geschieht durch Sputtern im Vakuum, das heißt durch Zünden eines Plasmas bei einer Spannung von 500 bis 600 Volt an einer Kupferkathode.
In dem dünnen Spalt zwischen der Kupferkathode und dem Glas wird ein Kupfernebel erzeugt, der sich auf das Substrat legt. Um die elektrische Ausbeute der solaraktiven Schicht zu verbessern, ist das Kupfer mit Gallium legiert, das den Wirkungsgrad des Moduls erhöht. So wird CIS zu CIGS. Anschließend wird Indium aufgesputtert. Dreimal durchläuft das Glas diese Sputterkaskade, stapelt dreimal Indium auf Kupfer und Gallium. Schließlich wird in einem Verdampfer eine Selenschicht aufgebracht. Am Ende wandert der Schichtstapel in einen Durchlaufofen. Bei zirka 500 Grad Celsius kristallisieren die metallischen Schichten zu einem einzigen Kup fer-Indium-Gallium-Diselenid-Molekül aus. In diesem Ofen wird gleichzeitig mit dem Zusatz von Schwefelwasserstoff ein Teil des Selens durch Schwefel ersetzt. Die Kristallisation ist der einzige Fertigungsschritt, der höhere Temperaturen erfordert. Damit ist er einer der wichtigsten Energieverbraucher der Fertigungslinie und lohnenswerter Ansatzpunkt für Verbesserungen: „Unsere Messungen ergaben, dass wir an dieser Stelle heute mit zwei Dritteln des ursprünglichen Energiebedarfs auskommen“, erklärt Tom Clarius, der Umweltmanager des Unternehmens. Die Forschungsabteilung testet zurzeit unterschiedliche Energieprofile aus. „Entweder niedrigere Temperatur oder kürzere Verweilzeiten. Beides spart Energie“, sagt Clarius.
Und dann ist da noch die Chemie: „Bei voller Auslastung der Produktion verbrauchen wir rund 4.000 Kilogramm Schwefelwasserstoff im Jahr. Das Prozessgas, das derzeit nur zu 20 Pro
zent ausgenutzt wird, soll deshalb in den nächsten Anlagengenerationen recycelt werden.“ Damit erwartet man sich weitere Kostensenkungen. „Das ist immer beides“, sagt Clarius. „Wenn wir weniger Schwefelwasserstoff verwenden, senken wir auch die Kosten für das Gas und die Sicherheitstechnik.“ Der Aufwand zur Nachbehandlung der Abgase ist nämlich nicht gering. In einem Gaswäscher wird der Schwefel mit Natriumhydroxid und Eisenchlorid ausgefällt. Der Fällschlamm wird in einer Filterpresse getrocknet, der Filterkuchen fachgerecht entsorgt. Das lassen sich die Recycling-Fachbetriebe teuer bezahlen.
Herausforderung Cadmium
Umwelttechnik ist nicht billig: Im ersten Werk in Torgau flossen ungefähr zwei Millionen Euro in die Reinigungstechnik für die Abgase und Abwässer. „Im Vergleich zu den Anfangszeiten haben wir den Wasserverbrauch schon um ungefähr 30 Prozent reduziert“, sagt Clarius. Jetzt sind es nur noch ungefähr 15 Kubikmeter pro Tag. Im Vergleich mit großindustriellen Betrieben ist das, laut dem Umweltmanager, fast nichts.“ Die Was sermenge wird weiter reduziert werden, wenn die Menge der Chemikalien durch bessere Ausnutzung abnimmt. Je weniger Chemie verwendet wird, desto geringer ist auch der Aufwand, sie auszuwaschen und aufzureinigen.
Die Avancis-Technologie teilt ein Problem mit anderen CIS-Herstellern wie Würth Solar, Solibro oder Sulfurcell: Cadmiumsulfid. Die Schwermetallverbindung wird zur Passivierung der Zell-Oberfläche verwendet. „Das sind extrem kleine Mengen“, sagt Hartmut Fischer, CEO von Avancis. „Nur wenige Moleküllagen dick.“ Sie schützt den Halbleiter bei der Aufbringung des transparenten Frontkontakts. Für die Mitarbeiter sei das Cadmiumsulfid keine Gefahr, sagt Hartmut Fischer. „Immer wenn bei uns Cadmium manipuliert wird, haben die Mitarbeiter die vorgeschriebene Schutzausrüstung an.“ Nach dem Laminieren der Module sei es zwischen den beiden Glasscheiben gefangen. Reste von Cadmiumsulfid werden in einer ammoniakalkalischen Lösung ausgefällt und von Spezialunternehmen entsorgt. Pro Jahr fallen nur wenige Kilogramm an. „Wir wollen aber cadmiumfrei werden“, betont Clarius. Um das Cadmium auszutauschen, erprobt Avancis derzeit zwei alternative Passivierungsschichten. Welche das genau sind, möchte Fischer mit Verweis auf die internationale Konkurrenz nicht preisgeben. Die endgültige Alternative soll schrittweise in den laufenden Betrieb integriert werden. Langfristig möchte „Avancis ein komplett grünes Produkt herstellen“, sagt Clarius.
Cadmium ist ein Reizwort für die CIS-Hersteller. Gerade jetzt, wo die Solarförderung weiter gekürzt werden soll, will man Kritikern keine weiteren Argumente liefern. Für die Hersteller spricht allerdings, dass sie sich schon vorher von diesem Problem befreien wollten und nach Ersatz suchten. Auf Cadmium kann auch Nikolaus Meyer vorerst nicht verzichten, Chef des CIS-Herstellers Sulfurcell. Seine Ingenieure prüfen Zinksulfid als mögliche Passivierung.
Das Berliner Unternehmen begann Anfang 2010 mit der automatischen Fertigung von CIS-Modulen. Die neue Fabrik soll jährlich 75 Megawatt leisten. Auch hier versucht man, die Stellschrauben in Richtung eines geringeren Energieverbrauchs zu verschieben. Bei Sulfur cell wird elementares Schwefelpulver im Vakuum verdampft, um die CIS-Verbindung auszubilden. „Rund 75 Prozent des Schwefels werden in die Halbleiterschicht eingebaut, das ist ein sehr effektiver Prozess“, meint Nikolaus Meyer. Und das Ergebnis von fortlaufender Optimierung. „Früher wurde eine Scheibe 75 Minuten lang auf 500 Grad Celsius erhitzt. Heute laufen die Module im Takt von fünf Minuten durch die Schwefelung. Wir haben die Energieverluste mehr als halbiert.“
Darin flossen die Erfahrungen aus dem jahrelangen Probebetrieb einer kleinen Pilotlinie von drei Megawatt ein. 85 Millionen Euro hat die neue Fertigung gekostet. Meyer glaubt, dass es bei der CIS-Schicht selbst kaum noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt: „Am Halbleitermaterial selber zu sparen, ist zweitrangig, da wir hier bereits sehr gut liegen. Die CIS-Schicht ist schon jetzt nur 1,8 Mikrometer dick. Perspektivisch könnten wir bis auf 1,5 Mikrometer kommen.“ Geringere Schichtdicke bedeutet allerdings auch, dass der Wirkungsgrad sinkt. Dann ist die Grenze der Einsparungen erreicht.