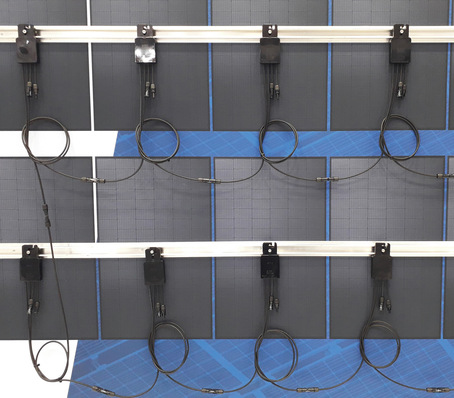Einen solchen Zwist hatte die Photovoltaikindustrie bis dato noch nicht erlebt: Im Sommer 2010 warfen sechs Schwergewichte der Branche, darunter Solarworld und Bosch, Konkurrenten vor, mit ihren Modulen hochgiftiges Cadmium zu verbreiten. Zugleich forderten sie die EU auf, die Verwendung von Cadmium und anderer giftiger Stoffe in der Photovoltaik zu verbieten. Andernfalls „würde bis zum Jahr 2020 eine unkontrollierbare Menge mehrerer tausend Tonnen toxischer Schwermetalle in Photovoltaikprodukten über die ganze Europäische Union verteilt werden“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.
Dieser harsche Vorwurf richtete sich in erster Linie an die Hersteller von Dünnschichtmodulen auf der Basis von Cadmiumtellurid (CdTe). Allen voran an First Solar. Der US-Konzern, der sich mit dem chinesischen Unternehmen Suntech ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position als Nummer eins der Solarbrancheliefert, fertigt ausschließlich CdTe-Module. Die Nachfrage nach diesen Produkten könnte angesichts sinkender Förderung in den nächsten Jahren stark wachsen, da CdTe-Module besonders günstig sind. Die Produzenten von kristallinen Siliziummodulen, die das Cadmiumverbot forderten, fürchten um ihre Marktanteile – und um das grüne Image der Branche. Sauberer Solarstrom und schmutzige Schwermetalle: Das geht nicht zusammen, meinen die Vertreter der kristallinen Photovoltaik. Deshalb verlangten sie von der EU, Solarmodule in die RoHS-Richtlinie („Restriction of the use of certain Hazardous Substances“) aufzunehmen, die die Verwendung gefährlicher Substanzen wie Cadmium in Elektronikgeräten verbietet. Das hätte First Solar wie auch die anderen CdTe-Hersteller vor gewaltige Probleme gestellt. Doch die Parlamentarier ließen sich von der Argumentation der Silizium-Fraktion nicht beeindrucken. Sie entschieden,die Photovoltaik auch künftig nicht durch die RoHS-Richtlinie zu reglementieren.
Die lautstarke Diskussion um Cadmium übertönte allerdings, dass mit der Aufnahme der Photovoltaik in die RoHS-Richtlinie noch ein weiteres Material auf die schwarze Liste gesetzt worden wäre: Blei. Kristalline Module enthalten dieses Schwermetall in geringen Mengen. Zwar „besteht ein riesiger Unterschied zwischen der Gefährlichkeit von Cadmium und Blei“, sagt Professor Jürgen Werner vom Institut für Physikalische Elektronik der Universität Stuttgart. Doch auch Blei ist nicht ohne. Das Schwermetall hemmt die Sauerstoffversorgung der Körperzellen und gilt deshalb als giftig. Bleiverbindungen, die über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden, reichern sich in Muskeln, Fettgewebe und Knochen an und können zu Defekten bei der Blutbildung und im Nervensystem sowie zur Zeugungsunfähigkeit führen.
Silber statt Blei
Wofür wird Blei in der kristallinen Photovoltaik überhaupt verwendet? „Blei taucht an zwei Stellen auf: zum einen beim Löten, zum anderen bei der Metallisierung der Zellen“, erklärt Harry Wirth, Leiter der Abteilung „Photovoltaische Module, Systeme und Zuverlässigkeit“ beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. So ist das Schwermetall Bestandteil derBlei-Zinn-Lote, die verwendet werden, um die einzelnen Solarzellen zu Strings zu verbinden. Ebenso ist das Material in Form von Bleioxid Bestandteil der Silberpaste, mit der die Zellen im Zuge derMetallisierung bedruckt werden. Diese Paste enthält bis zu fünf Prozent Glasfritte, sehr fein gemahlenes Glas, das zu einem großen Teil aus Bleioxid besteht. Die Glasfritte stellt eine Verbindung zurphosphordotierten Siliziumschicht her, so dass der Solarstrom von dort abgeleitet werden kann. Dabei ist die Fritte in der Lage, die etwa 70 Nanometer dicke Siliziumnitritschicht der Zellenoberfläche zu durchdringen. Dies geschieht durch Einbrennen in einem Durchlaufofen.
Doch es gibt Alternativen zum Blei, auch wenn diese einige Nachteile haben. Beim Löten lässt sich das Schwermetall zum Beispiel durch Silber ersetzen. Bei der Umstellung könnten die Solarfirmen von den Erfahrungen der Elektronikbranche profitieren, die wegen der RoHS-Richtlinie in ihren Produkten bereits seit fünf Jahren auf bleihaltige Lote verzichten muss. „Technisch ist es machbar, auch in der Photovoltaik bleifreie Lote zu verwenden“, sagt Wirth. „Aber die Variante mit Blei ist wirtschaftlicher, denn Zinn-Silber-Lote sind teurer. Dazu kommen indirekte Mehrkosten, weil die Schmelztemperaturen der bleifreien Lote höher liegen und anspruchsvollere Prozesse bei der Zell-Verstringung erfordern. Darüber hinaus muss man je nach Lötprozess mit einem stärkeren Verschleiß der Werkzeuge rechnen.“ Mit der höherenTemperatur steigt zudem die Bruchgefahr, denn die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Lot, dem das Lot tragenden Kupferbändchen und von Silizium unterscheiden sich. Kühlen die Zellen nach dem Löten ab, entstehen an den Lötstellen hohe mechanische Spannungen.
Auch bei der Metallisierung geht es bleifrei, denn das Bleioxid in der Silberpaste lässt sich durch die weniger problematischen Materialien Tantal oder Wismut ersetzen. Dabei können die Zellhersteller weiter mit ihren gewohnten Siebdruckverfahren arbeiten. Doch Pasten ohne Blei sind etwas teurer. Zudem verhalten sich die Alternativstoffe anders als Bleioxid: „Man muss viel herumtricksen, um die gleiche oder sogar eine bessere Performance als mit Blei zu bekommen. Das ist sehr schwierig und erfordert eine intensive Forschung“, sagt Sergiy Gnennyy, Sales & Project Manager bei der Centrotherm-Tochter GP Solar, die Zell- und Modulhersteller beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihrer Produktion berät. Gnennyy verweist jedoch darauf, dass für den Wirkungsgrad nicht allein die verwendete Paste entscheidend ist. „Es kommt auf dasZusammenspiel mehrerer Faktoren an: Welches Produktionsequipment benutzt ein Hersteller, welche Prozesse ver-wendet er, wie gut laufen sie, wie ist die Waferqualität? Dieses Zusammenspiel optimal zu steuern ist eine sehr komplexe Angelegenheit.“
Japaner mögen es bleifrei
Der Verzicht auf Blei ist also technisch nicht ganz trivial, aber möglich. Das zeigt das Beispiel von Mitsubishi. Das japanische Unternehmen verwendet bereits seit 2007 in allen seinen Photovoltaikmodulen keine bleihaltigen Lote und Pasten mehr. Diese Entscheidung fiel im Einklang mit der Konzernstrategie, sämtliche Elektronikprodukte bleifrei herzustellen. So will sich Mitsubishi gegen strenge Auflagen bei der Entsorgung ausgedienter Produkte wappnen. Aus dem gleich Grund hat Sharp beschlossen, seine kristallinen Module bis Anfang nächsten Jahres RoHS-konform ohne Blei herzustellen. Die Dünnschichtmodule von Sharp entsprechen der EU-Richtlinie schon heute. Für Mitsubishi ist die bleifreie Fertigung zudem ein zusätzliches Verkaufsargument. „Das hilft definitiv beim Gespräch mit dem Kunden. Zum Beispiel hat mir einer unserer Vertriebspartner berichtet, dass dies bei zwei oder drei von zehn verkauften Anlagen ein Thema sei“, erklärt Peter Langhein,der bei Mitsubishi Electric Europe als Produktmanager tätig ist.
Auch Solarworld sammelt bereits Erfahrungen mit der bleifreien Produktion. So verzichtet das Bonner Unternehmen in einer Produktreihe vollständig auf Blei im Lot sowie bei der Metallisierung. Allerdings machen die bleifreien Module bislang nur einen relativ kleinen Anteil der Gesamtproduktion aus. „Man sieht ihnen den Verzicht auf Blei nicht an, sie sehen genauso aus wie unser Hauptprodukt und werden unter dem gleichen Label verkauft“, sagt Holger Neuhaus, Geschäftsführer der Forschungstochter des Konzerns, der Solarworld Innovations GmbH. In der Fertigung war der teilweise Abschied vom Blei letztlich kein Problem. „Solarworld hat einen Prozess entwickelt, der höhere Temperaturen beim Löten zulässt. Deshalb können wir Lote, die statt Blei Silber und Kupfer enthalten, in Standardlinien verwenden“, so Neuhaus. Zellbruch sei kein Thema, die Bruchraten entsprächen denen der Produkte mit bleihaltigen Loten.
Ein großes Hindernis bei der vollständigen Umstellung auf eine schwermetallfreie Fertigung sieht Neuhaus dagegen in der Verfügbarkeit bleifreier Pasten. „Wir hängen bei der Metallisierungspaste stark von den Zulieferern ab. Die Mengen, die wir brauchen, werden gegenwärtig noch nicht angeboten.“ Ein Problem, das schnell gelöst wäre, wenn der Gesetzgeber mit einer Aufnahme der Photovoltaik in die RoHS-Richtlinie verbieten würde, Blei zu verwenden. „Wenn die Pastenhersteller ihre bleihaltigen Produkte nicht mehr verkaufen dürften und alle Solarunternehmen nach Alternativen fragen,haben sie die Prozesse sicher schnell umgestellt. Momentan müssen sie das nicht, weil die Nachfrage fehlt“, begründet Neuhaus, warum sein Unternehmen dafür trommelt, die RoHS-Richtlinie auch auf die Photovoltaik anzuwenden – obwohl Solarworld als Hersteller kristalliner Module davon betroffen wäre. Mitsubishi-Mann Langhein kann die These vom fehlenden Angebot an bleifreien Pasten weder stützen noch widerlegen, weil er sein Unternehmen in einer Sonderrolle sieht: Er geht davon aus, dass Mitsubishi die bleifreie Paste von einer anderen Tochter des Konzerns bezieht. Allerdings „halten sich die Kollegen in Japan in solchen Fragen sehr bedeckt“, begründet Langhein, warum er hier nur Vermutungen anstellen kann.
Grünes Image in Gefahr
Der Bleigehalt des Lots liegt pro Modul bei etwa zehn bis 20 Gramm. Das ist nicht viel, verglichen etwa mit den Mengen, die für Bleiakkus wie Autobatterien verwendet werden. Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland jedes Jahr 200.000 Tonnen Blei verbraucht, um Akkumulatoren zu bauen. Jürgen Werner von der Universität Stuttgart gefällt dieser Vergleich jedoch nicht. „Die RoHS-Richtlinie verlangt: Wenn es eine Alternative zu den giftigen Stoffen gibt, muss diese verwendet werden. In der Photovoltaik gibt es eine solche Alternative, bei den Autobatterien jedoch nicht.“ Er fordert die Solarhersteller auf, ihre Module ohne Schwermetalle zu fertigen, auch wenn sie nicht der EU-Vorgabe unterliegen. „Die Unternehmen vermarkten ihre Module als grüne Produkte. Aber zugleich sindsie schuld an einer großflächigen Verbreitung von Giftstoffen, obwohl es möglich ist, giftfrei zu produzieren. Das ist für mich nicht ökologisch.“ Fraunhofer-Forscher Harry Wirth argumentiert ähnlich. „Wenn die Branche mit Begriffen wie ‚grün’ und ‚nachhaltig’ werben will, sollte sie schleunigst damit aufhören, Materialien wie Blei oder Cadmium zu verwenden. Das ist eine Frage des Images und der Konsequenz.“ Wirth sieht das Problem mit Blei zum einen in der Produktion: „In der Fertigung verlangt der Umgang mit Blei Sicherheitsvorkehrungen, um beispielsweise Mitarbeiter vor Aufnahme des Schwermetalls zu schützen.“ Solarworld-Manager Neuhaus ist überzeugt, dieses Thema im Griff zu haben. „Nach unseren Messungen besteht keine Gefahr, dass bei der Metallisierung Blei in die Umwelt gelangt. Das Blei ist ja in der Glasfritte gebunden. Und selbst wenn bei der Feuerung Blei entweichen würde, könnte es trotzdem nicht in die Umwelt gelangen, weil die Abgase nachbehandelt werden. Ähnlich ist es beim Lötprozess: Die Temperaturen bewegen sich in einem Bereich, wo das Flussmittel verdampft, aber nicht die Metalle. Zudem gibt es auch hier Abzugseinrichtungen für die Abluft.“ Die größere Gefahr liegt jedoch darin, dass Blei freigesetzt wird, wenn die Module am Ende ihres Lebenszyklus ausrangiert werden. „Wenn Module unsachgemäß entsorgt werden, besteht die Gefahr, dass Blei über Auswaschen und Diffusionsvorgänge in die Umwelt gelangt“, fürchtet Wirth. Ein Recyclingsystem könne dies teilweise auffangen. Auf eine fachgerechte Entsorgung setzt auch Neuhaus. Allerdings weist er darauf hin, dass sich bei unsachgemäßer Behandlung oder einem Hausbrand nicht vermeiden lasse, dass Blei freigesetzt werde. „Deshalb sind wir auch so erpicht darauf, Blei aus Solarprodukten zu verbannen. Das Freisetzen von Blei in die Umwelt lässt sich am besten verhindern, wenn das Blei erst gar nicht in die Module kommt“, erklärt Neuhaus.
Wolfram Jaegermann vom Fachbereich Materialwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt dagegen hält die Debatte für verfehlt: „Ich bin irritiert, dass diese Diskussion überhaupt geführt wird. Am Beispiel Cadmiumtellurid zeigt sich doch, dass die Gefährdung zu vernachlässigen ist, wenn das Recycling funktioniert.“