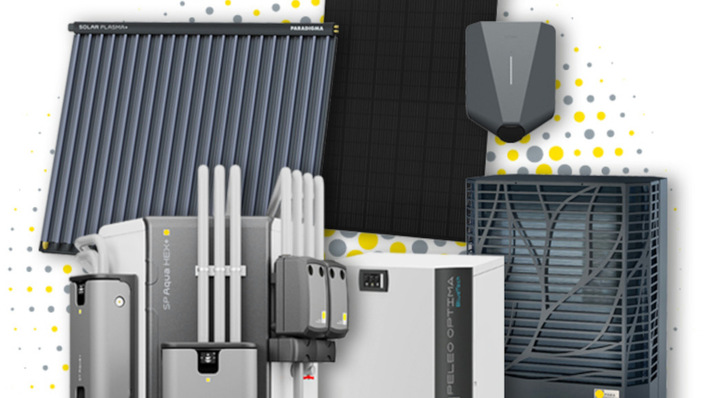Eigentlich ist das Einspeisemanagement nichts Neues. In der Windbranche ist es schon lange bekannt, und seit dem EEG 2009 war es auch schon für Photovoltaikanlagen mit mehr als 100 Kilowatt Leistung vorgesehen. Aufgrund von rechtlichen Unstimmigkeiten bei der Verwendung des Begriffs „Anlage“ konnte die Umsetzung zwar bisher noch hinausgezögert werden, ab dem 1. Januar 2012 ist es nun aber so weit: Photovoltaikanlagen mit mehr als 100 Kilowatt Leistung müssen zum vollständigen Einspeisemanagement fähig sein. Für Anlagenzwischen 30 und 100 Kilowatt wird ein sogenanntes vereinfachtes Einspeisemanagement verlangt. Anlagen unter 30 Kilowatt Leistung müssen sich entweder am vereinfachten Einspeisemanagement beteiligen oder ihre Wirkleistung am Netzverknüpfungspunkt auf 70 Prozent der Maximalleistung beschränken.
Für die kleinen Anlagen sind die Regelungen naturgemäß besonders kritisch, da bei ihnen ein zusätzlicher Einmalaufwand besonders ins Gewicht fällt. Dass die Beschränkung der Maximalleistung Betreiber nicht freut, versteht sich auchvon selbst. Bei den größeren Anlagen ist wiederum kritisch, dass sie auch rückwirkend von der Regelung betroffen sind. Bei Anlagen über 100 Kilowatt muss generell nachgerüstet werden, bei Anlagen zwischen 30 und 100 Kilowatt nur dann, wenn sie nach dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen wurden.
Doch was bedeutet eigentlich Einspeisemanagement? Wenn es zu Überlastungen im Stromnetz kommt, sollen Photovoltaikanlagen vom Netzbetreiber ferngesteuert in ihrer Leistung beschränkt werden können. Für das vereinfachteEinspeisemanagement ist dies schon ausreichend. Das vollständige Einspeisemanagement verlangt zudem, dass Informationen auch von der Photovoltaikanlage zum Netzbetreiber zurück übermittelt werden können. Nach der Meinung von Experten können auf diese Weise mehr Solaranlagen in das Stromnetz integriert werden, ohne dabei die Sicherheit des Netzes zu gefährden. Doch wie dies im Detail zu erfolgen hat, ist weitestgehend unklar. Für die Fernsteuerung von Anlagen ist im Gesetzestext zum Beispiel nur von „technischen Einrichtungen“ die Rede, mit denen der Netzbetreiber „die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann“. Die Alternative zum Einspeisemanagement bei kleinen Anlagen hört sich auch nicht besonders verlockend an. Eine pauschale Abriegelung der Anlagenleistung auf 70 Prozent verringert direkt die Rendite. Außerdem ist auch hier nicht klar, wie die Abregelung zu erfolgen hat.
Umsetzung kaum möglich
Dass die Vorgaben im EEG ungenau sind, ist aber nur ein Teil des Problems. Fragt man sich, wie viele Netzbetreiber ihren Kunden ab kommendem Januar die Möglichkeit des Einspeisemanagements anbieten können, wird klar: Es sind nicht viele. Bisher verfügen nur etwa 30 der deutschlandweit ungefähr 900 Verteilnetzbetreiber über entsprechende technische Einrichtungen. Die übrigen 870 haben noch kein solches System implementiert. Dass sie es bis Januar schaffen und den Anlagenbetreibern klare Vorgaben zur Umsetzung machen können, ist sehr unwahrscheinlich. „Es stellt sich also die Frage, wie sinnvoll es ist, das Einspeisemanagement jetzt auf breiter Ebene auch für kleine Anlagen zu fordern, wenn die meisten Netzbetreiber gar nicht dafür bereit sind“, sagt Michel Ryser, Produktmanager beim Schweizer Wechselrichterhersteller Sputnik Engineering. Bei den Herstellern von Wechselrichtern herrscht bezüglich der neuen Vorgaben des EEG eher Gelassenheit. „Auf unserer Seite sehe ich kein großes Problem“, sagt Ryser. „Unser aktuelles Portfolio ist zu 100 Prozent kompatibel mit dem Einspeisemanagement.“ Ähnlich sieht die Lage auch bei SMA und Power-One aus. Zusätzlich zum Wechselrichter brauchen Anlagenbetreiber dann einen Datenlogger, der die Signale vom Netzbetreiber für den Wechselrichter übersetzt. Solche Geräte bieten die meisten Hersteller von Wechselrichtern bereits an. Allerdings wissen auch die Wechselrichterhersteller nicht genau, welche Art von Signalen ihre Geräte zukünftig empfangen und übersetzen müssen. Theoretisch gibt es mehrere Möglichkeiten, Signale vom Netzbetreiber an eine Solaranlage zu übermitteln. Eine der vielversprechendsten Varianten scheint derzeit die sogenannte Funkrundsteuerung zu sein.
Dafür bräuchte dann jeder Anlagenbetreiber erst mal einen Funkrundsteuerempfänger. Er erhält die Signale des Netzbetreibers, wie der Name schon sagt, via Funk. Wolfgang Dotzler von der Europäischen Funkrundsteuer GmbH erklärt den genauen Ablauf derInformationsübertragung: „Wir betreiben in Deutschland zwei Langwellensender. Einen in der Nähe von Frankfurt und einen in der Nähe von Magdeburg. Damit decken wir praktisch die gesamte Bundesrepublik ab. Die Energieversorger oder Netzbetreiber wählen sich dann auf unsere Sendeanlagen ein und übermitteln von dort aus die nötigen Informationen. Jeder Akteur bekommt eine eigene Adresse. Damit kann er dann theoretisch jeden Funkrundsteuerempfänger einzeln ansprechen.“ Oft mache es aber Sinn, mehrere Funkrundsteuerempfänger zusammenzufassen, besonders wenn es sich um viele kleinere Anlagen handelt. Theoretisch könne man mit einem „Telegramm“ quasi unendlich viele Endgeräte gleichzeitig ansteuern, sagt Dotzler. Die Übertragung per Funk sei außerdem ein besonders schneller und kostengünstiger Weg, weil Netz- und Anlagenbetreiber dafür kaum neue Infrastruktur aufbauen müssen.
Doch das Funkrundsteuersystem hat auch Kritiker. Unter anderem, weil dieAnzahl der Steuerstufen üblicherweise auf vier Relais beschränkt ist. Für die Abregelung von Solaranlagen heißt dies, die Anlage kann nur auf 100, 60, 30 oder null Prozent der Anlagenleistung geregelt werden. Dotzler erklärt aber, dass theoretisch sechs Relais nutzbar seien. Dann könne man die Anzahl der Steuerstufen schon mal um zwei erhöhen. Außerdem sei die Europäische Funk-Rundsteuerung dabei, einen Empfänger zu entwickeln, der eine digitale Schnittstelle habe. Damit könnten Netzbetreiber den Wert dann auch in Ein-Prozent-Stufungen durchgeben. Sogar eine Blindleistungssteuerung sei so möglich.
Ein weiterer Einwand gegen die Funkrundsteuerung ist, dass es sich dabei um ein veraltetes System handele. „Die Rundsteuerempfänger sind die Lösung von heute, aber vielleicht nicht die Lösung von morgen. Die Übertragungsbandbreite ist sehr gering“, sagt beispielsweise Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Und Bernd Engel von SMA sagt dazu: „Klein-und Kleinstanlagen sollte man unserer Meinung nach eher über Internet oder Smart Meter als über Funkrundsteuertechnik ansprechen.“ Auch hiergegen wehrt sich Dotzler: „Unserer Meinung nach gibt es im Moment kein effektiveres und preisgünstigeres Medium als die Funkrundsteuerung.“ Damit sei es kein Problem, eine Million Geräte gleichzeitig innerhalb von zehn Sekunden ein- oder auszuschalten. „Wir könnten auch problemlos eine Million zusätzliche Solaranlagen steuern. Derzeit haben wir 1,4 Millionen Empfangsgeräte in Betrieb und damit eine Sendeauslastung von nur ungefähr drei Prozent.“ Eine sehr gravierende Schwäche des Funkrundsteuersystems ist allerdings, dass damit Informationen nur in eine Richtung übermittelt werden können. Dies wäre für das vereinfachte Einspeisemanagement, das für Anlagen mit weniger als 100 Kilowatt Leistung gefordert wird, kein Problem. Bei Anlagen mit mehr Leistung wird allerdings ein vollständiges Einspeisemanagementverlangt. Das bedeutet, Informationen müssen in beide Richtungen fließen. Dazu sind Funkrundsteuerempfänger nicht fähig.
Diskussion um Kommunikation
Um den Rückkanal zu öffnen, ist es also in jedem Fall nötig, auf andere Technologien zurückzugreifen und diese gegebenenfalls mit der Funkrundsteuerung zu kombinieren. Der Lastgang des Zählers der Anlage könnte beispielsweise über das Mobilfunknetz oder über das Internet an den Netzbetreiber zurück übermittelt werden. Nach Einschätzung von Dotzler ist diese Art der Datenübertragung zwar etwas langsamer und teurer als die Funkrundsteuerung, sie könne aber den Zweck, Informationen von der Solaranlage zum Netzbetreiber zu übermitteln, trotzdem gut erfüllen. Wenn Anlagen dann aber ohnehin eine Anbindung zum Mobilfunknetz oder dem Internet brauchen, stellt sich allerdings die Frage, ob eine zusätzliche Funkrundsteuerung überhaupt noch sinnvoll ist. „Ich kann mir auch vorstellen, dass es zukünftig SCADA-basierte Systeme gibt, wo die ganze Anlage vollständig in das Leitsystem des Netzbetreibers eingebettet ist“, sagt Ryser von Sputnik. „Das wäre aber eher eine Lösung, die für sehr große Anlagen interessant ist.“ SCADA steht für „Supervisory Control and Data Acquisition“.
Welcher technische Lösungsansatz der beste ist, darüber streiten derzeit die Experten. Abgeschlossene Untersuchungen gibt es noch nicht. Klar ist nur, es muss so schnell wie möglich ein einheitlicher Standard her. „Für die Anlagenbauer und die Netzbetreiber ist das Problem, dass nicht eindeutig standardisiert ist, wie die Funkrundsteuerung und insbesondere die Rückmeldung zu erfolgen hat“, sagt Ryser. „Vor allem für kleinere Anlagen unter 100 Kilowatt wäre es sinnvoll, vorher einen einheitlichen und zukunftsfähigen Schnittstellenstandard zu entwickeln.“ Bernd Engel, Senior Vice President Technology bei SMA und Sprecher der Arbeitsgruppe Netzfragen des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar), ist ähnlicher Ansicht: „Es wäre sehr unglücklich, wenn nun jeder der 900 Verteilnetzbetreiber seinen eigenen Standard einführen würde. Es ist wichtig, sich zuerst einmal auf einen einheitlichen Standard zu einigen. Dadurch würde dann auch das entsprechende Equipment etwas kostengünstiger.“ Seiner Ansicht nach macht eswenig Sinn, wenn Anlagenbetreiber jetzt Geld ausgeben, um Empfänger zu installieren, die die Netzbetreiber am Ende gar nicht ansteuern können. Es könne außerdem sein, dass sich die Technik in fünf Jahren wieder ändere. „Ich bin der Meinung, dass man bei kleineren Anlagen unter 100 Kilowatt zunächst noch abwarten sollte“, sagt Engel.
Wer die Kosten für das entsprechende Steuersystem übernimmt, ist derweil ebenfalls unklar, denn auch darüber verliert das EEG 2012 kein Wort. Fürden Datenlogger, das Verbindungsstück zwischen dem Funkrundsteuerempfänger und dem Wechselrichter, rechnet Michel Ryser von Sputnik mit Kosten von mehreren hundert Euro. Dazu kommen dann noch die Kosten zum Beispiel für einen Funkrundsteuerempfänger. Das sind etwa 200 Euro. Außerdem muss für das Funkrundsteuersystem auch noch eine entsprechende Nutzungsgebühr gezahlt werden. „Das ist ähnlich wie bei einem Handy. Da muss auch eine Nutzungsgebühr bezahlt werden“, sagt Dotzler.
Wer übernimmt die Kosten?
Die Kosten würden dabei derzeit ganz unterschiedlich auf den Anlagenbetreiber umgelegt. Für jemanden, der gerade eine Fünf-Kilowatt-Anlage auf seinem Hausdach plant, kann dies einen gehörigen Schrecken bedeuten. Gerade bei kleinen Anlagen können die Zusatzkosten für das Einspeisemanagement schnell fünf bis zehn Prozent der gesamten Investitionskosten ausmachen.
Mehrkosten müssen aber nicht nur für neue Anlagen mit eingeplant werden, auch viele Bestandsanlagen sind betroffen, wenn sie mehr als 30 Kilowatt Leistung bringen. Wenn er an die bevorstehenden Nachrüstaktionen denkt, ist Björn Blau vom Münchener Projektierer Futurasol schon ein wenig verärgert. „Wir erklären unseren Kunden nun, weshalb das Ganze notwendig ist. Die sind ja nicht alle Elektrotechniker.“ Futurasol baut überwiegend größere Anlagen auf Industrie- und Gewerbedächern. Vonden Nachrüstaktionen, die das EEG 2012 mit sich bringt, sind ungefähr 90 Prozent der Anlagen betroffen, die Futurasol bisher realisiert hat, schätzt Blau. „Die Kosten für die Nachrüstaktionen muss wahrscheinlich der Kunde übernehmen. Das ist weder für uns noch für den Kunden wirklich zufriedenstellend.“ Blau ist der Meinung: „Man hätte das im Vorfeld besser planen müssen. Zudem sind immer noch zu viele Dinge ungeklärt.“ Abschließend geklärt werden muss außerdem noch, wer bei einer Abregelung gemäß Einspeisemanagement für den entgangenen Stromertrag des Anlagenbetreibers aufkommt. „Wenn nach Einspeisemanagement abgeregelt wird, sollte dies entschädigt werden“, sagt der Sprecher der Gruppe Netzfragen des BSW-Solar Bernd Engel. „Wir arbeiten gerade zusammen mit dem BDEW an einer Entschädigungsregelung. Bei Kleinanlagen wird dies sicherlich pauschal erfolgen.“ Bei größeren Anlagen ist laut Ryser von Sputnik auch eine andere Lösung denkbar: „Als Basis nimmt man die letzte Einspeiseleistung ungefähr 15 Minuten vor der Abregelung, zum Beispiel aus den geloggten Werten eines Datenloggers. Der Wert wird dann über die Zeit der Abregelung aufintegriert. Das ergibt die Energie, die in der Zeit der Abregelung hätte eingespeist werden können. Das ist dann die Grundlage für den Netzbetreiber, um zu berechnen, welcher Betrag dem Anlagenbetreiber erstattet werden muss.“ Dies sei zwar nur eine Schätzung, komme der Realität aber meistens ziemlich nahe, meint Ryser.
Abregeln auf 70 Prozent Leistung?
Für Anlagen mit weniger als 30 Kilowatt Leistung bietet das EEG 2012 eine Alternative an. Anstatt der gelegentlichen Abregelung der Photovoltaikanlage durch den Netzbetreiber können sich Anlagenbetreiber auch dafür entscheiden, die maximale Wirkleistungseinspeisung ihrer Anlage am Netzverknüpfungspunkt pauschal auf maximal 70 Prozent der Generatorleistung zu begrenzen. „Von uns aus sind dann keine Änderungen an den Wechselrichtern nötig“, sagt Ryser. Das müsse der Anlagenplaner einfach entsprechend berücksichtigen, wenn er Generator und Wechselrichter dimensioniert. „Entweder er dimensioniert den Wechselrichter 30 Prozent kleiner oder die Generatorleistung um 143 Prozent größer.“ Anlagenbauer müssendabei allerdings beachten, dass manche Wechselrichter eine Leistungsreserve von zehn Prozent haben, also insgesamt auch 110 Prozent der Leistung bringen können. Das müsste bei der Auslegung des Wechselrichters ebenfalls berücksichtigt werden.
Doch ob sich die Abregelung auf 70 Prozent im Vergleich zum vereinfachten Einspeisemanagement rechnet, ist für viele Experten fraglich. Zwar geht eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES davon aus, dass sich die Verluste auf nur ungefähr zwei Prozent des Gesamtertrags beschränken. Bruno Burger vom Fraunhofer ISE ist da allerdings skeptisch: „Nach unseren Berechnungen bringt es zusätzliche Verluste von etwa sechs Prozent pro Jahr. Andere Studien kommen auf Werte von bis zu acht Prozent. Das heißt, die zwei Prozent, die das IWES in Kassel errechnet hat, erscheinen uns sehr gering.“ Ob zwei oder acht Prozent ist für die Renditeberechnung ein deutlicher Unterschied. Verlässliche, im Feld gemessene Daten gibt es aber leider noch nicht. Die Ergebnisse dürften allerdings auch je nach Generatortyp und Effizienzkurve des Wechselrichters unterschiedlich ausfallen.
„Ich halte die 70-Prozent-Regelung nicht für sinnvoll“, sagt Bruno Burger. „Wir wollen ja mehr und mehr PV installieren. Da halte ich das ferngesteuerte Einspeisemanagement für sinnvoller.“ Bernd Engel von SMA geht davon aus, das sich die pauschale Abregelung bei70 Prozent nur für Anlagen mit Eigenverbrauch rechnet. „Ziel dieser Regelung ist es gewesen, den Eigenverbrauch zu erhöhen. Es gilt bezüglich der 70 Prozent ja der Netzverknüpfungspunkt“, sagt er. Um den Strom trotzdem zu nutzen, biete SMA mit dem Home-Manager auch eine interessante Lösung an. Damit sei es auch möglich, eine Speichermöglichkeit wie den Sunny Backup zu integrieren. „Leute, die keinen Eigenverbrauch haben, werden aber sicherlich nicht die 70-Prozent- Kappung mitmachen“, meint Engel.
Fraglich ist zudem, ob Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen überhaupt eine Abregelung bei 70 Prozent vornehmen müssen, wenn die laut Gesetz mögliche Alternative, das Einspeisemanagement, nicht umsetzbar ist. Als Laie könnte man meinen, wenn ein Anlagenbetreiber das Einspeisemanagement vorzieht, kann er nicht zur 70-Prozent-Abregelung gezwungen werden, nur weil das Einspeisemanagement noch nicht umsetzbar ist. So einfach ist das deutsche Rechtssystem aber leider nicht.
Ein Gesetz, keine Richtlinie
Die rechtliche Komponente ist pikant. Denn wer ab kommendem Jahr seine Solaranlage ohne Einspeisemanagement oder 70-Prozent-Abregelung betreibt, der verstößt formal gegen das Gesetz. Interessant ist nun, ob sich die Netzbetreiber auf diese formale Rechtspflicht berufen, obwohl sie selbst die Voraussetzungen für das Einspeisemanagement noch nicht geschaffen haben. Einen rechtlich eindeutigen Weg, wie mit dieser Frage bei bestehender Rechtslage umzugehen ist, gibt es nicht.
„Wir haben es mit einem Gesetz zu tun, das so nicht vollzugsfähig ist“, sagt Rechtsanwältin Margarete von Oppen. „Eigentlich müsste das Gesetz geändert werden. Dazu wird man den parlamentarischen Gesetzgeber aber kaum bringen können. Also wird es darum gehen, eine pragmatische Lösung zu finden.“ Die Frage ist, wie diese praktische Lösung aussehen wird. Dafür sind BDEW und BSW-Solar in intensiven Gesprächen mit dem Bundesumweltministerium (BMU). Noch sind alle freundlich zueinander. Niemand möchte den anderen öffentlich angehen. „Das BMU war natürlich maßgeblich an der Erstellung des EEG beteiligt“, sagt Bernd Engel. „Nun unterstützt uns das Ministerium bei der Umsetzung. Es moderiert den Prozess, um ihn zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dafür sind wir dankbar.“ Mit einem gemeinsamen Statement zur Lösung des Problems kann laut BSW-Solar im November gerechnet werden.