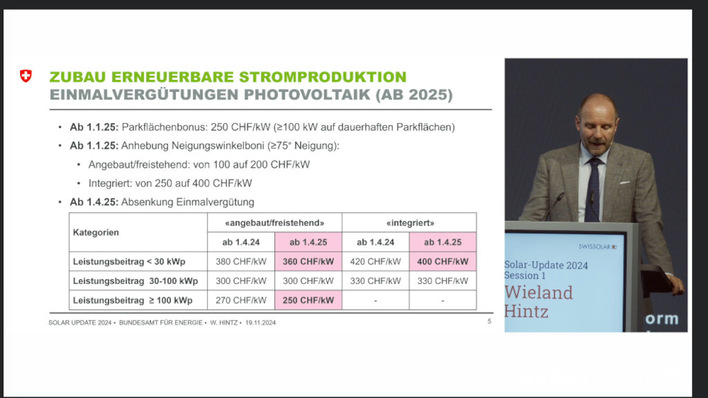Auch wenn schon vor Wochen durchgesickert war, dass im Nordosten von Halle eine große Fabrik für Dünnschicht-Module gebaut werden soll, gaben sich die zuständigen Wirtschaftsförderer des Landes Sachsen-Anhalt bei allen Anfragen unwissend oder – wenn die Fragen gar zu hartnäckig waren – als unbeugsam verschwiegen. „Wir können laut einer Vereinbarung mit dem Investor erst dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn das der Investor selbst entscheidet“, sagt Rainer Lampe, Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums in Magdeburg. Die IHK weiß „absolut nichts über ein solches Projekt“ und auch die Stadt Halle hällt sich mit Aussagen über den Investor zurück. Mit gutem Grund. Denn just auf dem gleichen Gelände, auf dem sich jetzt Intico Solar niederlassen will, wollte sich 2004 bereits BMW ansiedeln. Die Rathaus-Mitarbeiter konnten allerdings nicht dichthalten, was die Münchner gar nicht gut fanden und ihr Engagement stoppten. Und so lagen die für die Erschließung des Industrieareals bereits investierten 18 Millionen Euro jahrelang unverzinst im anhaltinischen Sand.
Roter Teppich ausgelegt
Schiefgehen darf diesmal nichts. In das Gelände unmittelbar an der Autobahn A14 wurden weitere 30 Millionen Euro gesteckt, um dem Investor den Weg zu bereiten. „Wir haben die allerbesten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Solarbranche hier weiter wächst“, sagt Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados. Er verweist auf das ebenfalls hier angesiedelte Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) und die Nähe zum Solar Valley. Doch zunächst muss auch die Chefin der Stadtverwaltung geduldig auf Post aus Wien warten: Mit einem Termin, wann es endlich losgeht.
Dass überhaupt der Name des Investors bekannt wurde, liegt ausgerechnet an der EU. Im Juli teilte die zuständige Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes mit, dass Brüssel einem Antrag für staatliche Beihilfen in Höhe von 73 Millionen Euro bewilligt habe. Die meisten Regionen in Ostdeutschland könnten aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und des geringen Durchschnittseinkommens hohe Förderquoten für Investoren anbieten, argumentierte sie. Zudem liege der Marktanteil von Intico unter 25 Prozent, auch nach der Inbetriebnahme. Schwupp, war der Firmenname bekannt.
Presse unerwünscht
Intico Solar bezeichnet sich selbst als „junges Unternehmen“. Im Internet präsentieren sich die Wiener äußerst bescheiden, ein paar nette Sprüche über die Kraft der Sonne, eine zu besetzende Stelle, eine Telefonnummer. Bis zum Jahr 2012 werde man „zu einem der führenden Hersteller für Dünnschicht-Photovoltaikmodule“ aufsteigen. Presseanfragen allerdings, die nur per Mail geschickt werden können, werden nicht beantwortet. Referenzen oder Projekte – Fehlanzeige.
Dafür finden sich bei Wirtschaftsdetekteien einige wenige, dafür aber interessante Details: Das am Handelskai 94/96 residierende Unternehmen hat danach ein gezeichnetes Kapital von 70 000 Euro und fünf Beschäftigte. Alleiniger Gesellschafter sei die Victory Industriebeteiligungen. Mit 35 000 Euro Stammkapital ist das aber auch nicht gerade das, was man hinter einem Projekt dieser Größenordnungen erwarten würde. Allerdings lassen die Namen im Aufsichtsrat aufhorchen: Georg Stumpf und Ronny Pecik sind in Österreich alles andere als unbekannte Newcomer. Im Gegenteil.
Rasanter Aufstieg
Pecik kam als Dreijähriger aus Kroatien nach Österreich, glänzte nicht gerade an der Schule und schlug sich nach einer Lehre als Elektriker mit Gelegenheitsjobs durch. Mit 19 kam er nach einer IT-Ausbildung zur Länderbank, später zur Bank Austria. Im Jahr 2000 war er immerhin schon Filialleiter einer Raiffeisenbank in Wien. Noch im gleichen Jahr begann er zusammen mit Freunden das Spekulieren: größere Beteiligungen eines Edelstahlherstellers wurden erworben und mit Riesengewinn wieder abgestoßen. Im Jahr 2003 ging es bereits um fast ein Fünftel der Aktien der VA-Tech, die später von Siemens gekauft wurden. Allein dieser Deal soll Pecik rund 70 Millionen eingebracht haben. Und nicht nur die Banken finanzierten die Geschäfte des passionierten Schachspielers und Golfers, auch potente Geschäftsfreunde aus Russland wie Viktor Vekselburg ließen Millionen sprudeln.
Der größte und wohl auch erfolgreichste Deal von Pecik war der Einstieg seiner Beteiligungsgesellschaft Viktory beim Schweizer Technologiekonzern Oerlikon im Jahr 2005, für den eine Summe von einer Milliarde Euro geflossen sein soll. Die Schweizer Wirtschaftspresse griff den recht spektakulären Karriereweg des Wieners gern auf und unterstellte ihm finstere Absichten. Die Journalisten befürchteten den raschen Ausverkauf des ohnehin in Schwierigkeiten steckenden Konzerns. Doch im Gegenteil: Zwar verkaufte Pecik auch hier zügig einen Großteil seiner Anteile – in diesem Fall vor allem an Vekselburg – doch Oerlikon steht heute allein schon gemessen am Börsenkurs weit besser da, als vor drei Jahren. Wie auch Pecik, der mit einem geschätzten Privatvermögen von 2,4 Milliarden Euro inzwischen als einer der reichsten Männer Österreichs gilt.
Maschinen von Oerlikon?
Der Kreis schließt sich: Oerlikon ist ein angesehener Produzent von Anlagen, die zu den Kernstücken einer Produktion von Dünnschicht-Solarmodulen gehören. Genau das Richtige also für den Aufbau einer großen Fabrik, für die nicht nur der Zugriff auf ausreichend Silizium, sondern auch kurze Lieferzeiten für die Ausrüstung wichtig sein können.
Oerlikon liefert auch Technologie für andere deutsche Solarfirmen. Eine von ihnen ist Ersol, das ebenfalls auf Dünnschichtmodule setzt. Man habe vor einem neuen Wettbewerber keine Angst, zumal ja bisher wenig Konkretes bekannt sei und auch auf der Intersolar in München, wo Intico immerhin einen Messestand hatte, seien die Wiener nicht gerade spektakulär aufgetreten, heißt es bei Ersol. Zudem sei der Markt immer noch in starkem Wachstum, auch auf der Herstellerseite.
Über mehr spricht man in Thüringen zu dieser Sache nicht – oder nicht gern. Dabei könnte man dort durchaus Grund haben, die Wiener argwöhnisch zu beobachten. Nicht nur, weil sich die Geschäftsfelder ähneln, denn gleich zwei der Intico-Geschäftsführer, Karsten Weltzien und Lutz Mittelstädt, waren bis Herbst letzten Jahres noch in gleicher Funktion bei den Thüringern. Die beiden dürften recht nützliche Kenntnisse mit an die Donau gebracht haben.
Auch Q-Cells bleibt gelassen
Ganz gelassen gibt sich auch der große Nachbar im nur 30 Kilometer von Halle entfernten Bitterfeld: „Wir haben nicht nur ein Projekt, sondern eine ganz reale Fertigung, zuverlässige Lieferverträge und stetig wachsende Kundenbeziehungen“, sagt der Konzernsprecher von Q-Cells. Natürlich sei eine neue Fabrik dieser Größenordnung eine Konkurrenz, aber „mindestens in diesem Jahr liege die Nachfrage noch deutlich über den Herstellerkapazitäten“ Bis 2011 werde am Markt ohnehin eine Konsolidierung fällig. „Mal sehen, wer dann so gut ist, dass er überleben kann.“