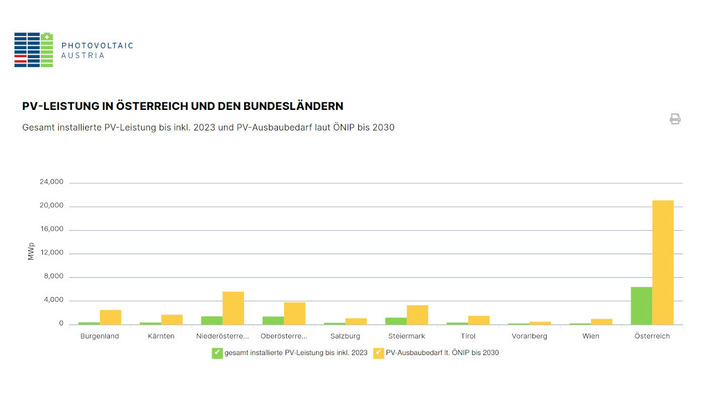Zwei Reaktionen sind möglich auf Anton Milners Verkündigung anlässlich der 23. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition PVSEC in Valencia. Der CEO von Q-Cells und Vorstandsmitglied der Europäischen Photovoltaikkonferenz stellte das neue Ziel des Europäischen Photovoltikverbandes EPIA vor. Statt wie bisher drei bis fünf Prozent solle sich der Industrieverband zwölf Prozent als neues Ziel für den Photovoltaikstromanteil 2020 setzen. Dabei sei vielleicht noch mehr drin: „Wir denken, das Marktpotenzial ist sehr viel größer“, sagte er. Das Ziel ist ehrgeizig. Wer hoch pokert, kann gewinnen, in diesem Fall die Unterstützung durch die Politik. Er kann aber auch seine Glaubwürdigkeit verlieren. Als Milner das Ziel am zweiten Konferenztag auf dem exklusiven Workshop der Top-CEOs vorstellte, wurde es dennoch fast einstimmig angenommen.
Dabei hätte in Spanien leicht Katerstimmung aufkommen können. Das stolze durch die Förderung erreichte Wachstum droht jäh abzubrechen. Während Experten den Zubau in Spanien dieses Jahr auf ein Installationsvolumen von über einem Gigawatt schätzen, wird die Unterstützung in Zukunft wohl einen Deckel bekommen. Anfang September plante die Regierung noch, dem Zubau über 300 Megawatt hinaus die Förderung zu entziehen. Bei Redaktionsschluss sah es so aus, dass der Deckel erhöht und aufgespalten wird. 300 Megawatt soll er bei Freilandanlagen betragen, 200 Megawatt für Dachanlagen. Die Vergütung sinkt gleichzeitig von 45 auf 32 bis 34 Cent für Dachanlagen und 29 Cent bei Freiflächenanlagen. Obwohl das schon der nachgebesserte Entwurf ist, ist die EPIA damit noch lange nicht zufrieden. „Wir hätten es auf jeden Fall vorgezogen, wenn der Deckel durch ein System ersetzt worden wäre, das ähnlich zu dem der Korridore in Deutschland ist“, sagt EPIA-Generalsekretär Adel El Gammal. Hierzulande soll die Degression der Einspeisevergütung in Abhängigkeit vom Wachstum erfolgen. Das begrenze die Kosten und bremse nicht gleichzeitig die Entwicklung des Markts.
Doch nach Katerstimmung sah es in Valencia nicht aus. Inzwischen hat man sich schon fast daran gewöhnt, dass jede neue Veranstaltung der Branche ihre Vorgängerin in jeder Hinsicht übertrifft. 715 Aussteller kamen dieses Jahr nach Spanien, letztes Jahr besuchten „nur“ 512 Firmen die PVSEC, damals in Mailand. Im Vergleich zur Messe vor vier Jahren verdreifachte sich die Zahl nahezu. Noch drastischer sieht die Entwicklung bei der Ausstellungsfläche aus: Sie stieg von 9.000 Quadratmeter in 2004 auf 50.000 dieses Jahr. Die Messe lockte über 20.000 Besucher an. Zur Konferenz, auf der eher wissenschaftliche Themen behandelt wurden, hatten sich 3.500 Teilnehmer angemeldet. Messe und Tagung sind also riesig, und das Programm erschlägt auch alte Hasen. „Der wichtigste Eindruck ist, dass es wirklich ein richtiger Industriezweig geworden ist“, sagt Michael Powalla, Leiter des Geschäftsbereiches Photovoltaik und Vorstand des ZSW, des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung in Stuttgart.
Dass es so weit kam, ist nicht zuletzt Visionären wie Mechthild Rothe zu verdanken. Sie wurde deshalb auf der Abschlussveranstaltung mit dem Bequerelpreis für außergewöhnliche Leistungen in der Photovoltaik ausgezeichnet. 1984 zog sie in das Europäische Parlament ein, 1994 bis 1996 war sie maßgeblich daran beteiligt, dass sich die EU das Ziel setzte, bis 2010 drei Gigawatt Photovoltaikleistung installiert zu haben, heißt es in der Laudatio. Heute ist sie Vizepräsidentin des Parlaments und Präsidentin des Europäischen Forums für Regenerative Energiequellen.
Rennen zwischen Technologien
Wenn es ums Detail geht, stehen in Valencia nach wie vor die zwei immer gleichen Trends im Mittelpunkt: billiger, besser oder beides. Billiger wollen nach wie vor die Dünnschichtproduzenten sein, was dazu führt, dass kaum noch jemand über den immer noch deutlich niedrigeren Wirkungsgrad ihrer Technologie spricht. „Die spannende Frage, die wir hier auch auf der PVSEC sehen, ist, wie wird die Zukunft aussehen im Rennen zwischen Dünnschicht und klassischer kristalliner Silizium-Photovoltaik“, sagt Eicke Weber, Leiter des Fraunhofer-
Instituts für Solare Energiesysteme. Große Durchbrüche hat er zwar keine ausgemacht, dafür aber viele Firmen, die die Dünnschichtentwicklungen vorwärtstreiben. Dazu gehören die beiden Anbieter schlüsselfertiger Produktionsanlagen, für Dünnschichtmodule aus amorphem Silizium, die bereits seit einiger Zeit Bewegung in die Branche bringen und während vergangener Messen die Diskussion bestimmt haben: Oerlikon Solar und Applied Materials.
Oerlikon punktet damit, dass bereits 400.000 Module mit der Technologie produziert worden seien, die das Unternehmen verkauft. Damit sei gezeigt, dass die Fabriken für die rund 1,5 Quadratmeter großen Module wirklich funktionieren. Pünktlich zur Messe nahm mit Sunwell, einer Tochtergesellschaft der Taiwanesichen CMC Magnetics, auch der erste asiatische Oerlikon-Kunde die Produktion auf. Die erste Anlage hat eine Kapazität von 40 Megawatt. Sunwell hat laut Oerlikon sogar schon weitere Produktionslinien gekauft und erweitert die Kapazität damit auf 220 Megawatt pro Jahr.
Applied Materials wirbt dagegen nach wie vor damit, dass die Maschinen der Firma besonders große Module produzieren. Das Unternehmen meldet am laufenden Band neue Verkäufe und gibt die verkaufte Jahresproduktionskapazität mit rund 1,5 Gigawatt an. Das Verkaufsargument, dass sich durch die Produktion der sechs Quadratmeter großen Module die Kosten senken ließen, scheint zu überzeugen.
Weitere Anbieter im Kommen
Daneben bieten jetzt aber auch weitere Anbieter Anlagen für amorphe Dünnschichtzellen an. So etwa Leybold Optics. Die Firma ging mit ihrer linearen PECVD-Maschine namens Phoebus an die Öffentlichkeit. PECVD heißt der Prozess, mit dem die Siliziumschichten aufgebracht werden. Die chinesische Firma Anwell macht mit seiner schlüsselfertig erhältlichen Fabrik Sunlite, die alle Komponenten von einer TCO-Beschichtungsmaschine bis zum Aufbringen der Rückseitenelektrode umfassen kann, den beiden großen Anbietern sogar direkt Konkurrenz.
Auf die Frage, wie er gegen die beiden eingeführten Konkurrenten bestehen will, lacht Eddy Wong, Manager für den internationalen Vertrieb. „Wir geben unser Bestes“, sagt er. „Wir glauben, dass unsere Technologie viel besser ist, da wir aus den Fehler der anderen lernen.“
So sehe der Kern der Dünnschichtfabrik, die PECVD-Maschine, aus wie eine Mischung der Oerlikon- und Applied -Materials-Technologie. Ähnlich wie Applied Materials nutzt Anwell für die verschiedenen Schichten mehrere Kammern in einem PECVD-Cluster, was laut Wong die Reinheit verbessere. Aber da das Format mit 1,1 mal 1,4 Meter kleiner ist als das von Applied Materials, könne Anwell mehrere Gläser auf einmal beschichten. Das erhöhe den Durchsatz. Die so produzierten Zellen hätten einen Wirkungsgrad von 6,5 Prozent, bei einem Durchsatz von 40 Megawatt pro Jahr und pro PECVD-Maschinencluster. Damit liegen die Chinesen ungefähr gleichauf mit den Wettbewerbern.
Einen großen Standortvorteil sieht Wong übrigens nicht. Zwar sei die Kostenstruktur in China etwas günstiger, doch die Arbeitskosten machten nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus. Er schätzt den Preisvorteil auf nur etwa zehn Prozent.
Dass Dünnschicht gegenüber kristallinen Zellen immer mehr an Boden gewinnt, zeigt auch, dass einer der weltgrößten Zellenproduzenten diese Technologie stark ausbaut: Sharp meldet die Verzehnfachung seiner Jahreskapazität auf 160 Megawatt dieses Jahr. Gleichzeitig kündigt das japanische Unternehmen den Bau der ersten Dünnschicht-Gigawatt-Fabrik an. Bereits 2010 sollen dort Triple-Junction-Module vom Band kommen.
Auch auf dem Dünnschichtmarkt für CIS-Module tut sich etwas. Sie bestehen aus den drei Elementen Kupfer, Indium und Selen, und ihr Wirkungsgrad liegt schon heute bei rund zehn Prozent. Bisher war Würth der einzige Hersteller, der die Module über eine gemeinsame Verdampfung der drei nötigen Elemente in großem Maßstab herstellte und verkaufte. Doch inzwischen ist auch die Q-Cells-Tochter Solibro so weit, die einen ähnlichen Abscheidungsprozess nutzt und einen totalen Flächenwirkungsgrad von elf Prozent erreicht. Mitte August hatte die 30-Megawatt-Produktionslinie das erste Megawatt hergestellt, bereits nächstes Jahr will die Firma ihre Produktionskapazität auf 135 Megawatt erweitern. Auch Avancis plant bald so weit zu sein. Die Firma arbeitet an einem alternativen Herstellungsprozess und hat vor kurzem in Torgau mit dem Ramp-up-Prozess seiner 20-Megawatt-Produktionslinie begonnen. Außerdem stellten Stangl Semiconductor Equipment und das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, das frühere Hahn-Meitner-Institut, auf der PVSEC das Spray-Ion-Layer-Gas-Reaction-Verfahren vor, mit dem die bei CIS-Technologien bisher nötigen sehr dünnen Cadmiumsulfid?schichten durch Indiumsulfidschichten ersetzt werden können, was einen ökologischen Vorteil bringen soll.
Auch Kristalline werden besser
Dünnschicht ist zwar im Kommen, doch auch die kristallinen Wafertechnologien, die ja nach wie vor den weitaus größten Teil des Marktes beherrschen, zeigen sich innovativ. „Es ist ganz klar, dass die Kernfrage Euro pro Watt ist“, sagt Weber. „Das heißt, alles, was hilft, die Kosten der Photovoltaik zu senken, wird sehr gerne gesehen.“ Das könne man tun, indem man die Effizienz der Solarzellen erhöht oder mit dünneren Wafern Silizium spart. Eine dritte viel diskutierte Variante sei, dass man so genanntes aufgereinigtes metallurgisches Silizium verwendet, nach dem englischen Ausdruck „Upgraded Metallurgical Silicon“ heißt es abgekürzt UMG-Silizium.
Auch damit geht es voran. Q-Cells hatte zwar schon vor einiger Zeit gemeldet, mit der norwegischen Firma Elkem langfristige Lieferverträge über UMG-Silizium abgeschlossen zu haben, um sich den Rohstoff für die zukünftige Expansion zu sichern. Jetzt zeigte Volker Hoffmann, Leiter der Abteilung Siliziummaterialien bei Q-Cells, in seinem Vortrag, dass sich auch daraus gute polykristalline Zellen herstellen lassen.
Bisher wurde das Material, das laut Hoffmann zirka 50-mal mehr Verunreinigungen enthält als das hochreine Halbleitersilizium, nur zu Teilen zugemischt. Hoffmann präsentierte Ergebnisse, nach denen man auch aus 100 Prozent dieses UMG-Siliziums Zellen herstellen kann, deren Wirkungsgrad über 15,5 Prozent liegt und nur 0,1 Prozent unter dem einer vergleichbaren Zelle mit geringerem UMG-Silizium-Anteil.
Der Kunde würde keine Unterschiede merken. „Im System wird sich das nicht unterscheiden“, sagt Hoffmann. Auf Zell- und Modulebene sind aber doch einige Tricks nötig, über die er nicht viel verrät. Man müsse vor allem genau Bescheid wissen, welche Verunreinigungen im Material vorhanden sind, „dann kann man das so berücksichtigen, dass man am Ende die Eigenschaften in dem Wafer bekommt, die man will.“ Trotzdem: „Man kann es nicht gleich gut machen wie mit Polysilizium.“ Durch die Verunreinigungen ist die Durchbruchspannung niedriger. Sie wird bei der Reihenschaltung innerhalb eines Moduls relevant. Wenn eine von mehreren in Reihe geschalteten Zellen verschattet ist, liegt an der Zelle, die keinen Solarstrom produziert, eine Spannung an. Übersteigt sie die Durchbruchspannung, kann die Zelle beschädigt werden. Das ist aber laut Hoffmann kein Problem, wenn man sie anders verschaltet.
Zumindest ökologisch ist das ein großer Vorteil. Laut Hoffmann spielen die mit dem UMG-Silizium hergestellten Solarzellen die zu ihrer Herstellung verausgabte Energie statt in rund drei bis dreieinhalb bereits in zwei Jahren wieder ein, da zur Aufreinigung des metallurgischen Siliziums deutlich weniger Energie benötigt wird als zur Herstellung des Halbleitersiliziums. Viel billiger werden die Zellen, die jetzt auf den Markt kommen sollen, aber vermutlich trotzdem nicht. Denn da Silizium zurzeit so rar ist, können die Hersteller auch für stärker verunreinigtes Silizium sehr hohe Preise verlangen.
CrystalClear vor dem Abschluss
Dass es nicht einfach ist, die Kosten zu senken, zeigt das EU-Projekt CrystalClear, an dem 16 Institute und Unternehmen beteiligt sind. Es ist vor vier Jahren mit dem Anspruch angetreten, die Produktionskosten von damals rund zweieinhalb Euro auf ein Euro pro Watt zu drücken. Demnächst läuft es aus, und Wim Sinke vom ECN in Petten, dem niederländischen Energieforschungsinstitut, stellte eine Kostenrechnung vor: „Die Hauptthese ist, dass alles, was einfach geht, bereits gemacht wurde“, gibt er zu bedenken. Es gebe keine Hauptkostenquelle, die man beseitigen könne. Deshalb drehten die Projektpartner an allen möglichen Schrauben, von der Siliziumherstellung bis zur Modulfertigung.
Eine Möglichkeit ist es, dünnere Wafer zu nutzen und Silizium zu sparen. Dass Solarzellen aus sogar nur 37 Mikrometer dünnen Scheiben funktionieren und einen Wirkungsgrad von rund 20 Prozent erreichen können, haben Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme bereits vor fünf Jahren gezeigt. „Aber wir können nicht zu dünnen Zellen und hohem Durchsatz gehen, wenn wir die bisherigen Verfahren beibehalten“, sagt Sinke. Das Problem ist, dass sie unter realen Produktionsbedingungen bei der Modulfertigung zu leicht brechen. „Die Zellhandhabung und die Verbindung zwischen den Zellen sind die kritischen Punkte“, sagt Sinke. Insbesondere Löten führt zu Spannungen im Wafer. Es könne sogar passieren, dass die Wafer erst später brechen, nachdem sie schon lange zu Modulen verarbeitet worden sind.
Sinke und seine Kollegen am ECN arbeiten deshalb an Technologien, wie sich Zellen mit wenig Belastung verarbeiten lassen. Das geht am besten mit Zellen, die nur auf der Rückseite kontaktiert werden müssen. Etliche Forschungsgruppen und Firmen arbeiten zurzeit daran. Das Schlüsselwort in Petten heißt Klebleitstoffe. „Wir nehmen eine Folie mit den notwendigen Leiterbahnen. Zuerst drucken wir leitende Klebstoffe an die Kontaktpunkte“, erklärt Sinke. Darauf kommt eine EVA-Folie mit Löchern dort, wo Kontakte entstehen sollen, und darauf die Zellen. Das wird mit einer zweiten EVA-Folie abgedeckt und mit einer Lampe geheizt, so dass der Klebstoff aktiviert wird und sich die Folien verbinden. Die Technologie funktionierte in einer Pilotanlage bereits an nur 130 Mikrometer dicken Zellen, die nur von der Rückseite kontaktiert werden müssen, „exzellent“. Was das genau bedeutet, will Sinke zwar nicht verraten, aber die Ertragszahlen lägen „nahe an 100 Prozent“.
Apollon Solars Wunderwerk
Für eine andere Methode zur Modulfertigung warb auf der Messe in Valencia Apollon Solar aus Lyon. Die Technologie heißt NICE, das steht für „New Industrial Cells Encapsulation“.
„Das ist das Wunderwerk“, sagt Apollon-Mitarbeiter Klaus Bamberg. Sein Unternehmen hat selbst nur fünf Mitarbeiter, entwickelt Ideen und nimmt für die Verwirklichung potente Partner mit ins Boot. Das Wunderwerk steht deshalb am Rand des Standes von ArcelorMittal. Wenn man darum herumläuft und das Modul von hinten betrachtet, weiß man auch, warum. Das Modul aus der Pilotlinie besteht hinten aus Metall, und deshalb gehört der Stahlhersteller mit zum Konsortium. Es sieht leicht verbeult aus. „Das sind die Kontakte.“ Sie drücken sich durch, denn im Innern herrscht Vakuum. „Das Wunder ist, dass wir kein EVA mehr benutzen und nicht löten“, erklärt Bamberg. Löten sei schlecht, denn dadurch entstünden Mikrorisse, die den Widerstand und damit die Verluste erhöhen. Ein Film zeigt, wie dagegen NICE funktioniert. „Das ist die rückseitige Metallfolie, dann wird die Randversiegelung aufgebracht“, erklärt Bamberg. Ein Roboter nimmt Bänder, die leiten und Zellen verbinden sollen, und legt sie aufs Metall. Ein anderer Roboter setzt Zellen auf, so dass die Kontakte an der richtigen Stelle sitzen. Dann kommt ein Glas dazu, die Presse schließt sich, und eine Pumpe evakuiert das Modul. „Damit ist die Kontaktierung über Druck gewährleistet, und solche Kontakte haben einen niedrigeren Widerstand als gelötete Kontakte“, sagt Bamberg. Durch die Automatisierung sänken die Lohnkosten auf ein Zehntel des Üblichen. Bereits auf der Intersolar stellte Apollon Solar die NICE-Technologie vor. Jetzt ist die Firma auf der Suche nach dem ersten Modulproduzenten, der eine Fertigungslinie kauft.
Zeit reif für Rückkontakt
Für die meisten der neuen Modulfertigungskonzepte sind jedoch Zellen nötig, die nur auf der Rückseite kontaktiert werden müssen. Die Idee ist nicht neu und wurde bereits in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts von Richard Swanson entwickelt. Das von ihm mit gegründete Unternehmen Sunpower verkauft solche Zellen schon seit einiger Zeit und meldete im Mai mit 23,4 Prozent einen neuen Wirkungsgradrekord. Doch jetzt scheint die Zeit reif dafür zu sein, dass sich auch Institute und andere Firmen mit der Idee beschäftigen. Eine davon ist die holländische Firma Solland Solar, die ihre Zelle Sunweb nennt, da sie aussieht, als sei sie von einem Spinnennetz überzogen.
Solland Solar nutzt die so genannte Metal-Wrap-Through-Technik. Pro Zelle schließen 16 Verbindungen die Ableitungen auf der Vorderseite an Kontakte auf der Rückseite an, so dass beide Pole der Solarzelle von hinten kontaktiert werden können und die Bus-Bars auf der Vorderseite entfallen. Dort liegen nur noch dünne Kontaktfinger, die jeweils sternförmig auf eine der Metallverbindungen zulaufen und der Zelle das charakteristische Aussehen geben. Mit dem Resultat, dass dadurch weniger aktive Fläche auf der Vorderseite der Zelle abgedeckt wird. „Der Zellenwirkungsgrad liegt 0,3 Prozent über dem der vorderseitig kontaktierten Zellen“, sagt Marketing- und Sales-Manager George Vervuurt. Der Vergleich fällt einfach, denn die Zellen können in der gleichen Produktionslinie gefertigt werden, auf der auch die konventionellen Zellen laufen. „Wir benötigen nur zwei zusätzliche Laser, einen, um die Löcher zu bohren, einen, um darum herum zu isolieren“, sagt er.
Noch stärker als bei einzelnen Zellen fallen aber laut Vervuurt die Vorteile auf Modulebene ins Gewicht. Die können dadurch mit den preiswerteren Pick- and-Place-Verfahren, wie sie zum Beispiel Sinke entwickelt, zu Modulen verarbeitet werden. Pick-and-Place ist das Zauberwort der Branche und bedeutet, dass Zellen nur noch auf eine Unterlage gelegt werden müssen und dann in einem Rutsch angeschlossen und zu Modulen verarbeitet werden. Da durch die Rückkontaktierung die Verschaltung an den Rändern entfällt, können die Zellen auch näher aneinandergerückt werden. Der Wirkungsgrad des Probemoduls liegt deshalb laut Vervuurt sogar 1,3 Prozent über dem des konventionellen Vergleichmoduls.
Zurzeit hat Solland Solar eine Produktionskapazität von 107 Megawatt. „Wenn ein Kunde so viel will, könnten wir 100 Megawatt der neuen Zelle produzieren.“ Momentan ist Solland jedoch noch in Gesprächen mit Modulherstellern, ob sie die neue Technik haben wollen.
Dass es mit der Rückkontaktierung vorangeht, zeigte auch die offensive Pressearbeit von Advent Solar. Ihr CEO Peter Green, der lange bei Intel und Texas Instruments arbeitete und erst letztes Jahr zu dem Solarzellenhersteller aus New Mexiko wechselte, empfing Journalisten mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. „Wir glauben, indem wir Halbleiterwissen anwenden, werden wir die Lernkurve Richtung Grid-Parity beschleunigen.“ Die Kontakte würden in der Solarindustrie nämlich noch in ähnlicher Weise hergestellt wie in der Halbleiterindustrie vor 1985: mit gelöteten Drähten. „Wir ändern das“, sagt Green. Er schwört auf ein ähnliches Konzept wie Sinke am ECN.
Die dafür notwendigen Zellen mit den Rückkontakten stellt das Unternehmen auch selber her. „Wir bohren mit Lasern tausend kleine Löcher“, erklärt Green, „darin lassen wir epitaktisch Silizium wachsen“. Experten bezeichnen das als Emitter-Wrap-Through-Technik, die die Vorderseitenkontakte nach hinten verlegt. Sie sind deutlich dünner als bei der Metal-Wrap-Through-Technik von Solland Solar und liegen so eng, dass keine Kontakte mehr auf die Vorderseite aufgebracht werden müssen, die wertvolle Solarzellenfläche verschatten. Mit ihrer Technologie kann die Firma laut Aussagen von Green die sonst üblichen Verluste durch die Kontaktierung von absolut vier Prozent auf 1,2 Prozent drücken. Er kündigt an, dass Advent bald eine 100-Megawatt-Fabrik in Europa bauen werde. Es seien auch bereits Lieferverträge über 230 Megawatt bis 2013 abgeschlossen worden. Verlässliche Messwerte über die Leistungsfähigkeit der Zellen wollte Green aber noch nicht präsentieren. Insofern muss sich erst noch erweisen, ob die Technologie hält, was sie verspricht.
Sinke stellte dagegen für CrystalClear eine detaillierte Kostenrechnung vor. Sie zeigt, dass trotz der neuen Technologien die Ein-Euro-Grenze zwar zunächst verfehlt wird. Wenn er jedoch die Kostensenkungen berücksichtigt, die bei Produktionskapazitäten von über 300 Megawatt pro Fabrik im Jahr erreicht werden können, sei ein Euro pro Watt realistisch.
Solarfremde wittern Geschäfte
Was auf der PVSEC auffällt, ist, wie Firmen aus anderen Branchen mit Know-how in die Photovoltaik drängen. Advent betont das Halbleiterwissen, das in seiner Technologie steckt. Sinke sagt, dass die Methode mit den Leitklebestoffen aus der Elektronikindustrie stammt. Und auch Dünnschichtspezialist Applied Materials kommt aus der Halbleiterbranche.
Doch nicht nur Halbleiterfirmen entdecken die Photovoltaik als Geschäftsfeld. „Materialanbieter haben jetzt die Photovoltaik auf dem Radarschirm“, sagt etwa ZSW-Forscher Powalla. Linde, ein Anbieter von Gasen, richtete zum Beispiel eine Nebenveranstaltung aus, bei der es um Gigawattfabriken ging, und stellte einen Prozess vor, mit dem bei der Dünnschichtproduktion das klimaschädliche Treibhausgas Stickstofftrifluorid durch Flour ersetzt werden kann. Der Chemikalienhersteller Merck bietet etwa eine Siliziumdioxidlösung mitsamt dem zum Auftragen nötigen Tintenstrahldrucker an und preist die Methode als billiger im Vergleich zu den bisher üblichen Vakuumprozessen. Auch Tesa war präsent, zum einen mit den Standardprodukten, die zum Verkleben von Rahmen und Anschlussdosen verwendet werden. „Wir halten aber auch Ausschau, wie groß das Interesse ist, bessere Lösungen zum Beispiel bei der Modulfertigung zu entwickeln“, sagt Marktmanager Bernd Bunde.
Zwölf Prozent erreichbar?
Auch wenn Experten zwar viele Verbesserungen, aber keinen großen Durchbruch auf der PVSEC gesehen haben, gibt sich EPIA-Generalsekretär El Gammal zuversichtlich, was das Zwölf-Prozent-Solarstromziel für 2020 angeht. Es beruhe auf einer Studie, die allerdings nicht veröffentlicht ist. „Die Studienergebnisse verlangen nicht einmal einen größeren technologischen Durchbruch“, sagt er.
Dem Ziel liegen Abschätzungen darüber zugrunde, wann Grid-Parity erreicht werden kann. Als Erstes wird das für Privatkunden in Italien der Fall sein. Unter optimistischen Annahmen ergibt sich für sie laut Anton Milners Vortrag die Grid-Parity schon 2009, unter pessimistischen Annahmen 2011. Kurz nach Italien komme Spanien an die Reihe, und auch in Deutschland werde die Grid-Parity bereits zwischen 2014 und 2018 erreicht. Wenn man annimmt, dass jeder Sektor, für den diese Grenze erreicht ist, ökonomisch sinnvoll mit Solarstrom versorgt werden kann, läge das Potenzial 2020 sogar bei 60 bis 90 Prozent des Gesamtstroms.
Das hört sich zwar nach viel an, ist aber keine realistische Annahme für den tatsächlich erreichbaren Zubau. Ein Teil davon wird nachts benötigt und kann daher nicht solar erzeugt werden, solange es keine ausreichenden Speicherkapazitäten gibt. Außerdem könne Solarenergie nur maximal den Anteil an Strom ersetzen, für den sowieso neue Kraftwerke gebaut werden müssen. Dann bliebe noch ein möglicher Anteil des Sonnenstroms von rund 40 Prozent. Da das Netz jedoch nur einen begrenzten Teil des Photovoltaikstroms aufnehmen könne, schlägt Milner die zwölf Prozent vor.
Die Besucher auf der PVSEC haben jedenfalls Zustimmung signalisiert. „Ich würde sagen, es hat einen großen Enthusiasmus hervorgerufen“, sagt El Gammal. „Es ist allerdings keine Vorhersage, sondern ein Ziel“, betont er. Das bedeutet, dass die Industrie bereit sei, alles dafür zu tun, und gerade eine Roadmap entwerfe, wie dieses Ziel erreicht werden könne. Damit es klappt, müssten aber Bedingungen erfüllt sein, für die die Politik zuständig sei. Das trifft besonders auf die Unterstützung in der Phase vor der Grid-Parity zu. El Gammal sieht gute Chancen, dass die Bereitschaft dazu vorhanden sein wird. Wenn das der Fall ist, muss die Photovoltaikindustrie tatsächlich zeigen, was sie kann.