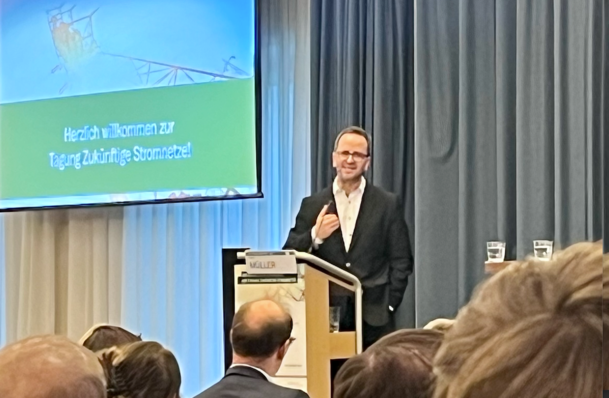Vielleicht steckt doch etwas Ausgleichendes im Prinzip Nachhaltigkeit. Der Grundton der Anfang August veröffentlichten Gewerkschaftsstudie ist versöhnlich. Man ist zuversichtlich, dass durch die Zukunftsindustrie Photovoltaik ein Cluster der industriellen Qualitätsproduktion in Ostdeutschland entstehen könnte. Keine Spur von dem Säbelgerassel, das Spiegel-Online in einem Vorabbericht über die Studie Ende Juni in Szene setzte („üble Ausbeuter“, „Tarifvertrag, Betriebsrat, Mitbestimmung – in der Öko-Branche will man davon nichts wissen“).
Die Studie „Solarindustrie als neues Feld industrieller Qualitätsproduktion“, die vom IMU Institut für Medienforschung und Urbanistik im Auftrag der Wissenschaftsstiftung der Industriegewerkschaft Metall, der Otto Brenner Stiftung, verfasst wurde, formuliert „Gestaltungsanforderungen für die Nachhaltigkeit der ostdeutschen Standorte“ aus Sicht der Gewerkschaft. Im zweiten Teil wird der Kenntnisstand über die Arbeitsbedingungen in den Betrieben dargestellt, der erste, längere Teil beschreibt die Branchenstrukturen und Netzwerke zwischen Unternehmen, Politik und Forschung. Es wird klar: dieses hochgradig vernetzte Umfeld will die Gewerkschaft stärker mitgestalten.
„Die Situation in den Unternehmen ist ausgesprochen heterogen, man kann nicht ein fach verallgemeinern“, erklärt Walter Krippendorf, Chef des IMU-Instituts in Berlin. Insgesamt jedoch, stellt die IMU-Analyse fest, liegen die Arbeitsbedingungen in der ostdeutschen Photovoltaikindustrie deutlich unter den Standards der Metall- und Elektroindustrie. Ungünstigere Arbeitsbedingungen bietet die Branche in den Kategorien Einkommen, Weiterbildung, Leiharbeiteranteil, Schichtregelungen und Möglichkeiten zur Interessenvertretung.
Tarifloser Zustand
Hauptgründe für den niedrigen Arbeitsstandard sind nach Ansicht der Studienautoren das Fehlen von Arbeitnehmervertretungen in vielen Betrieben – „Skepsis gegenüber Betriebsräten bis zur offenen Ablehnung“ – und der „tariflose Zustand“ des Industriezweigs. Die Solarunternehmen im Osten Deutschlands sind häufig in Branchenverbänden, aber selten in tariffähigen Unternehmensverbänden organisiert – laut Deutschem Gewerkschaftsbund nur zu 15 Prozent, Windkraftunternehmen hingegen zu 42 Prozent.
Das könnte sich ändern, da dies auch ein Thema im Bundesverband Solarwirtschaft ist. Carsten Körnig, Geschäftsführer des Verbands, der über 600 Solarunternehmen vertritt, sagt dazu: „Der Bundesverband Solarwirtschaft befindet sich derzeit noch in der Abwägung, ob er zukünftig auch die Rolle eines Arbeitgeberverbandes wahrnehmen soll.“ Damit verbunden sei unter anderem eine Analyse, wie groß der Bedarf nach eigenen Tarifverträgen für die Solarindustrie ist.
Einstweilen werden die Löhne vor allem einzelvertraglich geregelt, deshalb gibt es große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Aber auch innerhalb der einzelnen Unternehmen, stellt die Studie fest, gibt es eine große Variationsbreite in der Bezahlung gleicher oder ähnlicher Tätigkeiten. Nach Ansicht der Gewerkschaft ist das immer ein Garant für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Die Bruttomonatsverdienste der Fabrikarbeiter liegen laut IMU-Untersuchung im Allgemeinen zwischen 1.600 Euro und 2.200 Euro, aber es gibt auch Bruttostundenlöhne, die knapp über acht Euro liegen, und Einstiegslöhne knapp über sieben Euro. Zum Teil gibt es dreizehnte Monatsgehälter, zum Teil auch Betriebsrenten. Insgesamt jedoch, stellt die Studie fest, pendelt sich das Lohnni veau auf einem Bereich von etwa zehn Prozent unter dem tariflichen Niveau ostdeutscher Branchentarifverträge ein.
Ein weiterer Kritikpunkt der Studie ist die Schichtgestaltung: Laut Studie sind in ostdeutschen Photovoltaikwerken sogenannte „Conti-Schichtmodelle“ verbreitet, mit Produktionszeiten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Die Aufsichtsbehörden bewilligen problemlos Ausnahmen vom Verbot der Sonntags- und Feiertagsarbeit nach Paragraph 13 des Arbeitszeitgesetzes, wenn die Unternehmen darlegen, dass andernfalls ihre Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt wäre. Die Genehmigung von zwölfstündigen Arbeitsschichten ist Ermessenssache der Aufsichtsbehörden, vorausgesetzt, es werden zusätzliche Freischichten angeboten.
Manche Schichtarbeiter der Branche können auf diese Weise auf eine Wochenarbeitszeit von 60 Stunden mit wechselnden Schichten inklusive Nachtschichten kommen – und dadurch einen Block von vier Freitagen hintereinander ansammeln. „Bei einigen stößt das auf Akzeptanz“, sagt IMU-Chef Walter Krippendorf, doch für ihn ist klar: Es gehört zu den gesicherten Erkenntnissen der Arbeitsmedizin, dass solche Schichten die Gesundheit der Beschäftigten gefährden und die Unfallgefahr steigern können. „Da gibt es Gestaltungsbedarf“, erklärt Krippendorf, „für manche Alleinstehende mag das eine Zeit lang funktionieren, aber für Familienmenschen ist das ein Riesenproblem.“
Begrenzte Möglichkeiten
Weitere Themen der Studie sind unsichere Arbeitsplätze – die hohe Verbreitung von befristeten Stellen, Zeitarbeit, Leiharbeitsverhältnissen – und die begrenzten Weiterbildungsmöglichkeiten. Als „Operator“ in der Produktion werden laut IMU-Studie häufig arbeitslose Facharbeiter mit fachfremder Berufsausbildung eingestellt. Die Vermittlung der Fachqualifikation während einer Anlernphase wird dann häufig mit Fördergeldern der Agentur für Arbeit finanziert.
„Es ist eine Abwärtsgruppierung zu beobachten“, sagt IMU-Chef Krippendorf. „Die Grundqualifikation der ostdeutschen Facharbeiter war zunächst höher als im Westen, da es in der DDR einen höheren Anteil qualifizierter Fachkräfte gab. Heute arbeiten Ingenieure oft als Facharbeiter, und Facharbeiter als angelernte Kräfte.“ Die Aufstiegmöglichkeiten in den Betrieben seien sehr begrenzt, sagt Krippendorf, Zusatzqualifikationen als Meister oder Techniker würden kaum angeboten. Siegfried Wied, politischer Sekretär in der IG Metall Verwaltungsstelle Ostbrandenburg in Frankfurt/Oder, beschreibt die Folgen für die Gemeinden: „Viele qualifizierte Leute wandern ab, vor allem diejenigen mit guter Ausbildung und die jungen. Wenn die nach der Ausbildung keinen vernünftig bezahlten Folgejob finden, sagen die ‚ich hau ab in den Westen’.“
Da freuen sich die Unternehmen in Bayern und Baden-Württemberg, die nach den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit immer noch am stärksten vom Facharbeitermangel in Deutschland betroffen sind. Doch inzwischen spricht man aber auch im Osten der Republik von einem Fachkräftemangel. Nach einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Arbeitsagentur wollen drei Viertel der ostdeutschen Betriebe in den nächsten zwei Jahren zusätzliche Facharbeiterstellen besetzen. Ein Drittel der Unternehmen erwartet Probleme bei der Rekrutierung von Fachkräften.
Probleme anderer Art haben die Facharbeiter im Osten, die immer wieder als der herausragende Standortvorteil für die Photovoltaikindustrie gelobt werden. Auf die Motivation und die Stimmung in den Städten wirken sich die Hartz IV-Gestze und die Unsicherheit über den Wert von Qualifikationen bedrückend aus. Misstrauen scheint angebracht in Prenzlau, einer brandenburgischen Kleinstadt mit gut 20.000 Einwohnern und einer aktuellen Arbeitslosenquote von 19,5 Prozent. Die Erfahrung, wie aus dem Armaturenwerk Prenzlau mit rund 1.500 Mitarbeitern die AWP Kälte-Klima-Armaturen GmbH mit heute 75 Beschäftigten wurde, steckt den Bewohnern immer noch in den Knochen. Hoffnungen verbinden sich mit Skepsis. „Aleo Solar“, sagt der Taxifahrer, „ja, das ist ein wichtiger Arbeitgeber. Aber die sind ja nur hier, weil sie soviel Förderung erhalten“.
Erste Etappe: Prenzlau
Aleo Solar beschäftigt in Prenzlau in einem der größten und modernsten Modulwerke Europas etwas über 500 Mitarbeiter, rund 400 davon arbeiten in der Fertigung. 2002 startete Aleo Solar die Produktion in Prenzlau mit 20 Mitarbeitern und einer Jahreskapazität von 15 Megawatt, Ende des Jahres waren es schon 100 Mitarbeiter, 2005 wurde die Produktion auf 90 Megawatt aufgestockt. Zurzeit werden ein neues Logistikzentrum und eine neue Produktionslinie aufgebaut. In „Aleo III“ entstehen weitere 100 Arbeitsplätze, so dass die Jahreskapazität auf 180 Megawatt ausgedehnt werden kann.
„In der Solarbranche ist ein Unternehmen, das nicht jedes zweite Jahr verdoppelt, schnell nur noch die Hälfte wert“, erklärt Martin Mack, Betriebsleiter des Aleo-Werks in Prenzlau. Dass bei einem so raschen Wachstum nicht alles sofort rund laufen kann, gibt der Ingenieur unumwunden zu.
Unzufriedenheit kam auf, die Angestellten forderten mehr Pausenräume, Raucherinseln, bessere Arbeitszeitregelungen, angenehmere Temperaturen in den Werkshallen. Und die IG Metall mischte sich ein. Auf der DGB-Konferenz „Gute Arbeit durch Erneuerbare Energien“ im November 2007 hatte der Bevollmächtigte der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf, das Ziel formuliert, in einem Unternehmen nach dem anderen Betriebsräte einzuführen, als erstes bei Aleo Solar in Prenzlau.
Auf allzu großen Widerstand stieß die IG Metall in Prenzlau nicht. Seit Ende Januar gibt es einen Betriebsrat bei Aleo Solar. „Der Vorstand hat die Einführung des Betriebsrats begrüßt“, sagt Betriebsleiter Martin Mack. „Damit gibt es ein Bindeglied zwischen Unternehmensführung und Belegschaft, eine Brücke, die für beide Seiten gut ist.“ Seitdem, erzählt er, sind auch die Begegnungen mit Gewerkschaftsvertretern freundlicher geworden. Was ihm damals nicht so gut gefiel, war das Vorgehen der IG Metall. Zunächst, berichtet Mack, sei nur die Belegschaft angesprochen worden, Flugblätter wurden verteilt. „Die Gewerkschaft ist durch die Hintertür auf uns zu gekommen, statt direkt zu kommunizieren. Schade“, meint Mack, der früher selbst mal IG Metall Mitglied war, „denn damit wurde das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmen und Belegschaft aufs Spiel gesetzt.“ Am Anfang habe es lange Diskussionen gegeben mit dem neuen Betriebsrat, in den relativ junge Mitarbeiter gewählt worden waren. Inzwischen jedoch habe sich die Kommunikation sehr gut entwickelt, berichtet Mack, „es wurde einiges auf den Weg gebracht“.
Die soziale Verantwortung des Unternehmens in der Region ist ein wichtiges Thema für den Betriebsleiter. Die meisten Aleo-Mitarbeiter kommen aus der Region, 95 Prozent aus einem Umkreis von zehn Kilometern. Die meisten neuen Mitarbeiter werden von der Agentur für Arbeit vermittelt, über 90 Prozent der Neuen werden nach einer Trainingsphase eingestellt. „Es gibt in der Uckermark viele gute Fachleute“, sagt Mack, „aber viele wandern ab. Es gibt auch Leute, die wieder kommen, aber diese Rate ist immer noch gering.“
Was ist gute Arbeit?
Von sozialer Verantwortung spricht die Branchenstudie des IMU Instituts für Medienforschung und Urbanistik nur indirekt, im Versuch zu bestimmen, was „gute Arbeit“ in den Werkhallen wäre. „Gute Arbeit“ versteht sie als „Zukunftsprojekt“, das auf sichere Arbeitsplätze, anspruchsvolle Arbeit, hohe Qualifikation der Beschäftigten, ein sozialverträgliches Maß an Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt.
Mit diesem Begriff nähert sich die Gewerkschaft bewusst den Diskussionen der Unternehmerverbände: Das Projekt „gute Arbeit“, heißt es in den Schlussfolgerungen der Studie, sei „anschlussfähig zu anderen Branchenstrategien wie beteiligungsorientierter Innovationspolitik (‚besser statt billiger’), nachhaltiger Unternehmensentwicklung und mitarbeiterorientierter Unternehmens- und Führungskultur.“ Werte werden benannt, Ziele abgesteckt, ähnlich wie in den Unternehmerdiskussionen über „Corporate Social Responsibility“ (deutsch: soziale Unternehmensverantwortung, wobei die Geschäftswelt es lieber auf Englisch sagt, oder noch lieber abgekürzt: CSR). Immer mehr deutsche Firmen greifen den Trend auf und präsentieren sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in der Kommunikation mit Investoren, als sozial verantwortliche Arbeitgeber mit einer nachhaltigen Unternehmenskultur.
Das CSR-Prinzip wurde zunächst von großen Unternehmen und internationalen Institutionen ausgerufen, 1999 im „Global Compact“ der Vereinten Nationen, 2001 in einem Grünbuch der Europäischen Kommission. Ende vergangenen Monats gab die Bundesregierung die Einberufung eines CSR-Forums bekannt. Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Leitbegriff heißt „UnternehmensWerte“, die Hauptthemen sind „Verbraucherinformation“, „Umwelt“, „Globalisierung“ und – „Gute Arbeit“.
Vorbildliche Arbeitgeber
CSR-Wettbewerbe werden durchgeführt, Preise verliehen. Bei der Ausschreibung „Deutschlands beste Arbeitgeber“, an der unter anderem das Arbeitsministerium und die Zeitschrift Capital beteiligt sind, wurde dieses Jahr auch ein Unternehmen der Solarbranche ausgezeichnet: die SMA Technologie AG, die 2006 schon einmal unter den Top 5 der „Besten Arbeitgeber“ Europas war und vom Beratungsunternehmen Ernst & Young zum deutschen „Entrepreneur of the year“ gekürt wurde. Das Unternehmen mit rund 2.450 Mitarbeitern formuliert sein Angebot an die Belegschaft so: aktive Einbindung in alle Entscheidungsprozesse, Freiräume, Eigenverantwortung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Die Leitbilder, erklärt SMA-Personalleiter Jürgen Dolle, sind „offene Kommunikation, gegenseitiger Respekt und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse“. SMA-Chef Günther Cramer erklärt dazu in seinen Vorträgen über gute Unternehmenskultur: „Wir wollen die Herzen, die Köpfe und die Geldbörsen beteiligen.“
Von der IG Metall hat er das nicht. Vielleicht liegt es ja am Prinzip Nachhaltigkeit, das in der Branche allgegenwärtig ist.