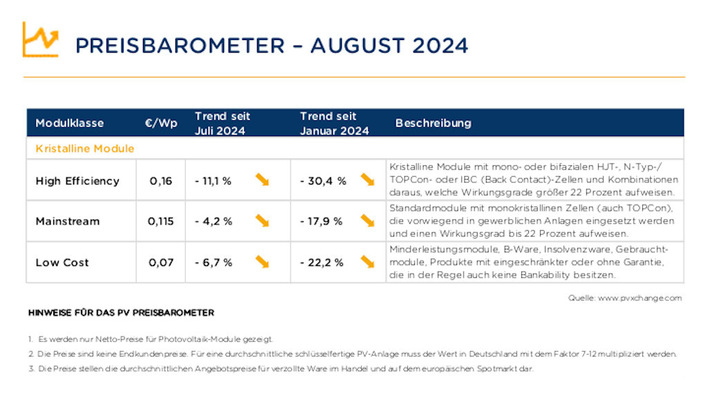„Noch mal passiert uns das nicht. Deswegen haben wir doch gerade in Deutschland Anlagen gebaut und nicht international: Weil wir dachten, dass man hier nicht mal einfach eben so die Gesetze ändern kann.“ Mathias Mönkeberg, Geschäftsführer der 1-A Solar GmbH aus Schweinfurt in Bayern, klingt bitter. Mönkebergs Geschäfte sind Freiflächenanlagen auf Äckern. „Mit der EEG-Novelle gehen uns 30 Projekte kaputt.“ Er ist betroffen vom krassesten Einschnitt der Neuregelungen: Für Photovoltaikanlagen auf ehemaligen Ackerflächen, die nach dem 1. Juli 2010 in Betrieb genommen werden, wird der Vergütungsanspruch komplett gestrichen.
Mit einer Ausnahme: Anlagen nach Paragraf 32 EEG, die vor dem 1. Januar 2011 in Betrieb genommen werden und im Geltungsbereich eines vor dem 25. März 2010 beschlossenen Bebauungsplans liegen. Ursprünglich war sogar der 1. Januar 2010 als Stichtag geplant. Mit dieser Regelung wollte die Regierung eigentlich die Planer von Großprojekten, deren Vorbereitung einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Vorlauf benötigt, entlasten. Doch die Umsetzung ist nicht gut gelungen.
Langwieriges Prozedere
Denn der Ablauf sieht so aus: Der Planer sucht eine Fläche, prüft, ob sie geeignet ist, und pachtet sie von einem Bauern. Dann stellt er sein Vorhaben der Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde sich grundsätzlich zur Möglichkeit der Aufstellung einer Photovoltaikanlage auf dem betreffenden Gebiet bekennt, erfolgt der Aufstellungsbeschluss. Mit ihm beauftragt das Kommunalparlament seine Verwaltung, einen Bebauungsplan für das Gebiet zu erarbeiten und das für die späteren Entscheidungen wichtige Material zusammenzutragen. Im dann folgenden Beteiligungsverfahren werden die Betroffenen, die Träger öffentlicher Belange, die Nachbargemeinden und die allgemeine Öffentlichkeit über die Planungsabsichten informiert und zur Stellungnahme aufgefordert. Wenn die Stellungnahmen zu keinen oder nur geringfügigen Änderungen führen, wird der Bebauungsplan von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Dann kann der Bau der Anlage losgehen.
Erst mit der Satzung ist der Bebauungsplan für die Stadt als auch für den Grundstückseigentümer bindend. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Planer aber bereits gut und gerne je nach Größe der geplanten Anlage 100.000 bis 200.000 Euro und viel Zeit investiert, um eine geeignete Fläche zu suchen, zu prüfen und die Formalitäten zu regeln. Das ist der Grund, warum viele Planer gerade verzweifeln. Sie haben ihre Projekte gemeinsam mit der Gemeinde vorangetrieben, alle Beteiligten wurden gehört, es wurde sich geeinigt – aber der Satzungsbeschluss ist nicht mehr vor dem 25. März veröffentlicht worden. All diese praktisch fertig geplanten Anlagen sollen nun keine Einspeisevergütung mehr bekommen?
„Der Begriff Bebauungsplan ist doch eine völlig wachsweiche Formulierung“, bringt Mönkeberg seinen Unmut über den unpräzisen Gesetzestext zum Ausdruck. Auch Jürgen Kittelmann, Geschäftsführer der Agentur für Assistenz und Beratung, treibt dies um. Seine Agentur berät aktuell einen Kunden, der in vier Projekte auf Ackerflächen in der Region Kulmbach in Bayern investiert. Die notwendigen Unterlagen sind komplett, nur: Der für die Projekte verantwortliche lokale Planer hatte ganz auf den Aufstellungsbeschluss gesetzt. Kittelmann ist nun extra deswegen aus Hannover zum 5. Fachgespräch der Clearingstelle EEG am 9. Juli nach Berlin gereist.
Böses Erwachen für viele Beteiligte
Eine Reise mit bösem Erwachen: „Die Übergangsvorschrift des Paragrafen 32 Abs. 3 Nr. 3 spricht von einem ‚beschlossenen Bebauungsplan‘. Darunter ist der endgültige Satzungsbeschluss zu verstehen“, erklärt Juristin Hanna Schumacher, die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in Fragen zum EEG unterstützt, beim Fachgespräch. Auch Christoph Weißenborn, Fachgebietsleiter beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, sieht das so. Kittelmann: „Die Gemeinden, die wir vertreten und denen wir nun die Antwort schuldig sind, hatten mit Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, und die Landwirte hatten die Flächen bereits vor Zeiten aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen. Es wurde demnach auch keine Saat eingebracht – und auch keine Ernte erzielt. Das ist bitter für den Landwirt. Und es ist bitter für die Gemeinde, denn dort wurden die Sitzungen und Veranstaltungen nicht nur koordiniert, sondern es wurden auch erhebliche finanzielle Mittel eingesetzt.“
So eindeutig, wie nun vom BMU kommuniziert, ist die Sachlage für Jürgen Kittelmann bei weitem nicht. Er zitiert aus einem Brief von Norbert Röttgen von Anfang Mai, in dem sich der Bundesumweltminister an die Mitglieder der CDU/CSU- und FDP-Fraktion richtet. Darin spricht Röttgen vom Bebauungsplan und nicht vom „beschlossenen Bebauungsplan“. „Nach meiner Meinung wollte Röttgen einen besonderen Vertrauensschutz für die sich im B-Plan befindenden Verfahren herstellen. Ich denke, er wollte die Kommunen und Ämter schützen, damit im laufenden Verfahren keine Eingriffe vorgenommen werden, welche die Kommunen zum Anlass nehmen würden, eine entsprechende Klage am Verwaltungsgericht gegen das BMU zu führen“, sagt Kittelmann. „Der Gesetzestext ist interpretierbar, aber aus dem Kontext ergibt sich, dass der Gesetzgeber vermutlich den Aufstellungsbeschluss gemeint hat“, meint auch Rechtsanwalt Lars Ritterhoff von der Kanzlei Dr. Binder, Flaig und Ritterhoff. „Sicher ist der Planer aber nur mit der konservativen Auslegung, also dem Satzungsbeschluss“, fügt er hinzu. Die Frage, ob der Aufstellungs- oder der Satzungsbeschluss gilt, werden nun Gerichte klären müssen.
Abgesehen von der rechtlichen Verwirrung bezüglich des genauen Beschlusstermins, hilft die Ausnahmeregelung gerade den bayerischen Solarleuten nur wenig. Denn am 19. November 2009 hat die Regierung von Oberbayern einen neuen Landesentwicklungsplan des Landesinnenministeriums mit Handlungsanweisungen für Kommunen zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen veröffentlicht, der die Genehmigungen in den ersten drei Monaten des Jahres erheblich erschwerte. Anfang März legte der Bundesumweltminister dann seinen ersten Entwurf der EEG-Novelle vor. „Da entwickelt man innovative Anlagen, setzt sich mit der Kommune auseinander, geht komplett in Vorleistung, und dann heißt es von oben ‚ellabätsch‘, wenn ihr nicht bis zu einem Termin, der bereits vorbei ist, eine Genehmigung hattet, dann könnt ihr alles vergessen“, sagt Mönkeberg. „Die Branche sorgt sich inzwischen mehr um die ganzen Unsicherheiten als um die Höhe der Degression“, meint Susanne Jung, Rechtsexpertin des Solarenergie-Fördervereins (SFV).
Inzwischen ist sich zumindest die Regierung einig. Nach leichten Modifizierungen des Gesetzestexts im Vermittlungsausschuss wurde am 9. Juli beschlossen, die neuen Regelungen rückwirkend zum 1. Juli in Kraft zu setzen. Damit die Bürger sich auf staatliches Handeln verlassen und ihm vertrauen können, gilt eigentlich ein grundsätzliches Rückwirkungsverbot für Gesetzesänderungen. Außerhalb des Strafrechts gibt es aber Ausnahmen. Ohnehin ging es im Vermittlungsausschuss nur noch um die Höhe der Degression, der Ausschluss der Ackerflächen war bereits beschlossen. „Der Gesetzesbeschluss erfolgte bereits am 6. Mai, deswegen kann Vertrauensschutz nicht geltend gemacht werden.
Verbesserungen können nachträglich eingefügt werden, als solche wird die Splittung der Degression gewertet“, sagt Juristin Hanna Schumacher. „Ich gehe davon aus, dass bei der EEG-Novelle die Rückwirkung zulässig ist, da seit März der Gesetzesbeschluss vorliegt und sich alle Betroffenen darauf einstellen konnten“, so Rechtsanwalt Lars Ritterhoff.
Solarrausch im ersten Halbjahr
Und die Solarbranche hat sich darauf eingestellt: Die drohenden Kürzungen lösten im ersten Halbjahr einen wahren Solarrausch aus. Allein in den ersten drei Monaten wurde nach vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur eine Photovoltaikleistung von insgesamt 714,7 Megawatt in Deutschland neu installiert. „Im Juni sind wahrscheinlich 60.000 Anlagen ans Netz gegangen, das entspricht voraussichtlich 1.700 Megawatt. Das sind aber noch keine offiziellen Zahlen“, sagt Jörg Meyenborg, Leiter des Referats IT-gestützte Datenverarbeitung der Bundesnetzagentur. Die für Solarfreunde eigentlich schöne Meldung hat auch ihre Kehrseite. „Seit der Röttgen das erste Mal den Mund aufgemacht hat, wird auf dem Markt jeglicher Schrott aufgekauft, nur um Anlagen zu komplettieren und irgendwelche Fristen einzuhalten. Das ist Wirtschaftsförderung für China von der allerfeinsten Sorte“, urteilt Anlagenplaner Mönkeberg.
Für ihn und seine Kollegen, die an einer per Bebauungsplan vor dem 25.März genehmigten Anlage nach Paragraf 32 EEG bauen, gilt es nun, die verlängerte Frist zur Inbetriebnahme bis Ende des Jahres zu schaffen, ansonsten treffen sie die Kürzungen besonders hart. Steht die Anlage auf einer Ackerfläche, erhält sie dann überhaupt keine Vergütung mehr. In Zahlen gesprochen: von vormals rund 29 Cent pro erzeugter Kilowattstunde auf null. Freiflächenanlagen auf sogenannten Konversionsflächen (siehe Kasten) werden um acht Prozent auf 26,15 Cent gekürzt, zuzüglich der neuen Degressionsstufe ab Oktober mit weiteren drei Prozent dann auf 25,37 Cent. Anlagen auf sonstigen Freiflächen erhalten vor dem 30. September 25,02 Cent pro Kilowattstunde, ab Oktober dann 24,26 Cent.
Zum Jahreswechsel erwartet die Anlagenbauer eine weitere Absenkung der Einspeisetarife. Nach den von Meyenborg genannten Installationszahlen wird sie bei mindestens 13 Prozent liegen. Der Gesetzgeber will den Bau von Großanlagen auf ökologisch wertvollen Freiflächen eindämmen und eine Überförderung ausschließen. „Insofern sind die Vergütungskürzungen ein harter, aber an diesen Zielen gemessen ein konsequenter Einschnitt. Sie sind auch geeignet, die Glaubwürdigkeit des EEG als zielgerichtetes und angemessenes Förderinstrument in der öffentlichen Wahrnehmung wieder zu stärken“, meint Rechtsanwalt Florian Valentin von der Kanzlei Schnutenhaus und Kollegen in Berlin.
Wer zu spät kommt, bekommt nichts mehr, heißt also die Devise. Deswegen werden die Anlagenbauer erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die Anlage rechtzeitig in Betrieb zu nehmen. Doch was bedeutet eigentlich Inbetriebnahme? Denn erst ab dem Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme steht dem Betreiber nach Paragraf 3 Nr. 5 EEG 2009 eine Einspeisevergütung pro erzeugter Kilowattstunde zu.
Auch diese Frage trieb wochenlang private wie gewerbliche Planer von Photovoltaikanlagen um, denn der Run auf Solaranlagen ließ die Wechselrichter knapp werden. Aber ohne Wechselrichter kann kein Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden. Die große Unsicherheit bewegte in den vergangenen Monaten viele Investoren. Sie wandten sich an die Clearingstelle, die am 26. Juni ihren Hinweis zum streitbaren Paragrafen veröffentlichte. Insgesamt neun Verbände und Institutionen haben im Vorfeld dazu Stellung bezogen.
Das Urteil der berufenen Stelle lautet nun: Eine Photovoltaikanlage ist dann in Betrieb, wenn in ihr erstmals Strom erzeugt und dieser außerhalb der Anlage verbraucht wird. Als Anlage ist dabei jedes Modul definiert. Beispielhaft erläutert die Clearingstelle, dass es zur Inbetriebnahme ausreicht, an ein Modul oder einen String eine Verbrauchseinrichtung wie eine Glühbirne oder aber einen Akku anzuschließen. Das bloße Anliegen einer elektrischen Spannung an den Anschlussklemmen der Anlage reicht zur Inbetriebnahme nicht aus. Der Vorgang der Ingangsetzung muss außerdem auf Geheiß des Betreibers erfolgen – bringt der Modulhersteller oder der Installateur die Glühbirne zum Leuchten, läuft der Vorgang nur unter „Test“.
„Die Glühbirne ist ein unglücklicher Ausdruck“, sagt Ralf Haselhuhn von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. „Besser wäre es, deutlich zu machen, dass anstelle des Verbrauchstroms auch der nachgewiesene Messstrom für die Inbetriebnahme ausreicht. Sonst haben
viele Installateure erst mal ein Problem, weil kein passendes Messgerät vorhanden ist.“ Haselhuhn plädiert dafür, die VDE 0126-23 (IEC 62446) "Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme - Mindestanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen" in den Hinweis der Clearingstelle aufzunehmen. „Wenn der Installateur sich an dieses Prozedere hält, ist er auf der sicheren Seite.
Auch ohne Wechselrichter
Ganz klar drückt sich die Clearingstelle bei den raren Wechselrichtern aus: Sie sind zur Inbetriebnahme nicht erforderlich. Ebenso wenig die vorherige Anmeldung zum Netzanschluss, eine Netzverträglichkeitsprüfung, die Verlegung des Netzanschlusses oder von Anschlussleitungen, der Anschluss beziehungsweise der Betrieb von Zähl- oder Messeinrichtungen für die Einspeisung des in dem Modul erzeugten Stroms in ein Stromnetz. Die Inbetriebnahme bedarf also keiner Mitwirkung des Netzbetreibers.
„Wir sind mit dem Hinweis der Clearingstelle sehr zufrieden“, sagt Susanne Jung vom SFV. Freilich blieben den Betreibern zwischen der Veröffentlichung der Stellungnahme zum 26. Juni und der in Kraft tretenden Degression zum 1. Juli nur vier Tage Zeit. „Der späte Zeitpunkt ist wirklich schade“, meint Jung, „aber viele Verbände und auch Netzbetreiber gerade im Süden haben auch schon vorher zu diesem Vorgehen geraten. So sind viele tausend Anlagen auf diese Weise vorläufig in Betrieb gegangen. Mit dem Hinweis der Clearingstelle haben die Betreiber nun eine Absicherung.“ Natürlich ist die Aussage der Clearingstelle nicht rechtlich bindend. Aber: „Vor Gericht hätte der Hinweis sicher ein erhebliches Gewicht“, sagt Rechtsanwalt Valentin.
Aussagen des Betreibers über den Vorgang der Inbetriebnahme sind allerdings vor Gericht nicht als Beweismittel verwendbar, Zeugenaussagen Dritter hingegen schon. Daher sollte der Betreiber im eigenen Interesse die Inbetriebnahme durch Beauftragung Dritter und Dokumentation, also durch Protokolle, Fotos oder Videoaufnahmen, sichern, so dass im Streitfall die Inbetriebnahme aller Module bewiesen werden kann. Für diejenigen Betreiber, für die es mit dem Endjahrestermin der Ausnahmeregelung knapp werden sollte, gilt dann, dass sie die in Teilen fertige Anlage im Sinne des Paragrafen 32 EEG nach dem eben beschriebenen Verfahren in Betrieb nehmen sollten, um sich so zumindest einen Teil der alten Vergütung zu sichern. So lässt sich der wirtschaftliche Schaden eingrenzen.
Bundesumweltminister Norbert Röttgen sagte nach der Einigung im Vermittlungsausschuss: „Das ist ein wichtiges Signal: Investoren und Unternehmer haben jetzt Klarheit für ihre Investitionsentscheidungen.“ In den Ohren von Jürgen Kittelmann, dessen Klienten möglicherweise in einen Solarpark investiert haben, für den es keine Vergütung mehr geben wird, klingt das wie Hohn und Spott. Planungssicherheit sieht seiner Meinung nach anders aus. Viele Anlagenplaner und -bauer stehen vor der Frage, wie es weitergehen soll. „Gewerbeflächen sind zu teuer, Konversionsflächen sind meistens schon mit naturschutzrechtlichen Dingen belegt – ich verabschiede mich aus Deutschland“, ist Mönkebergs Fazit dazu.