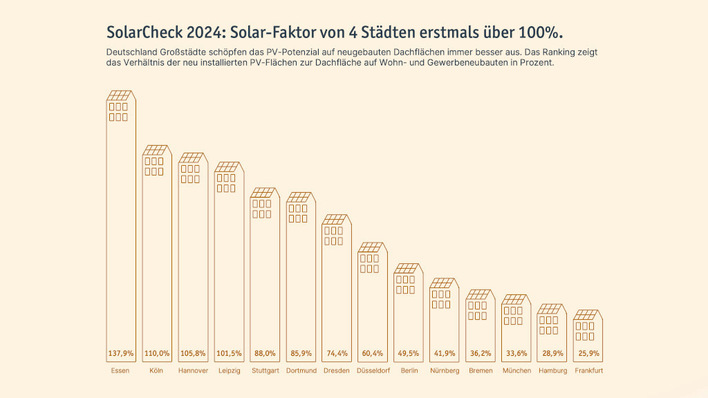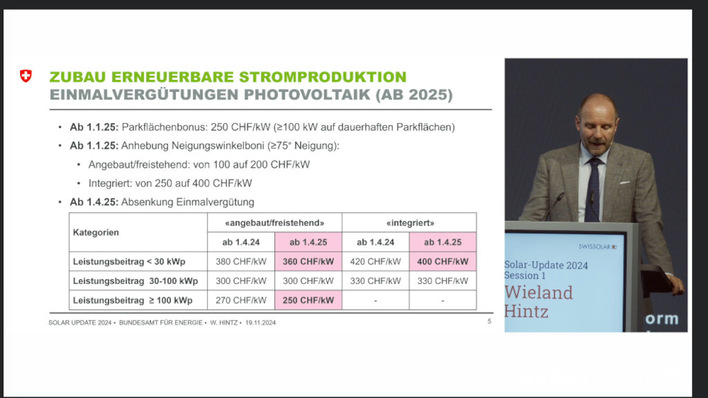Es war einmal in Ostdeutschland: Solarunternehmen investieren in große Fabriken. Hoffnung auf eine Zukunft für alte Industriestandorte wie Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, das brandenburgische Frankfurt (Oder) und Freiberg in Sachsen keimt auf. Die deutsche Solarindustrie scheint vor einer goldenen Zukunft zu stehen. An den Aktienmärkten zahlen Anleger für Papiere deutscher Solarunternehmen wie Q-Cells (100 Euro) und Solarworld (48 Euro) Höchstpreise. Das war im Jahr 2007.
Im Frühjahr 2012 klingt dieses Szenario angesichts der Hiobsbotschaften aus den deutschen Firmen von Millionenverlusten und Pleiten, die tausende von Arbeitsplätzen und die regionale Wirtschaftskraft bedrohen, wie ein Märchen aus alter Zeit – was mancher Beobachter schon immer gewusst haben will. „Wir argumentieren seit Jahren, dass in Europa nur der Downstream-Bereich oder Hightech-Firmen überleben können“, sagtJesse Pichel, Analyst des US-Finanzdienstleisters Jefferies. „Wer nur ein ‚Commodity-Produkt’ herstellt, kann nicht mit China mithalten.“ Seine Einschätzung deutscher und europäischer Solarindustrieführer fällt drastisch aus: „Als Profi betrachte ich es als Versäumnis, dass es mir nicht gelang, die Vorstände von Solarworld, Q-Cells, REC und anderen davon zu überzeugen, Produktionslinien in China aufzusetzen. Sie haben nicht zugehört, weil sie zu arrogant waren, die Wettbewerbsbedrohung aus China nicht wahrhaben und sich stattdessen auf den guten Zeiten ausruhen wollten, die durch die einfachen Förderprogramme ausgelöst wurden, die nun aber zu Ende gegangen sind.“ Das sehen allerdings nicht alle so, wie das Streitgespräch auf Seite 52 zeigt.
Besonders die Produzenten kristalliner Standardware aus deutschen Landen haben es schwer. Nach den Pleiten der einstigen Pioniere Solon und Q-Cells könnte auch bei den verbleibenden konzernunabhängigen Firmen wie der Solarworld Ungemach drohen. Schon Ende 2011 hatte die Firma außerplanmäßige Abschreibungen auf ihr Sachanlagenvermögen von 340 Millionen Euro vornehmen müssen. Die betrafen laut Geschäftsbericht 2011 je zur Hälfte die Fertigung in den USA (156 Millionen Euro) und Deutschland (153 Millionen Euro). Grund waren die enormen Überkapazitäten am Markt, durch die alte Produktionslinien rasant an Wert verlieren.
Nach Auskunft von Solarworld-Sprecher Milan Nitzschke seien diese Wertberichtigungen aber „sehr konservativ“ ausgefallen, hätten also bereits einen sehr starken Wertverfall berücksichtigt. Doch an der Marktsituation mit Überkapazitäten und Preisverfall hat sich auch nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 wenig geändert, so dass weitere Abwertungen ins Haus stehen könnten, die die Bilanzen erneut belasten würden. Dies würde allerdings für alle Firmen in der Branche gelten.
Langer Atem gefragt
Die Schweizer Bank UBS spricht in einer Investmentanalyse des Unternehmens jedoch auch von „nicht konkurrenzfähigen Produktionsanlagen“. Im aktuellen Marktumfeld hält es UBS-Analyst Patrick Hummel daher für unwahrscheinlich, dass Solarworld auf absehbare Zeit zurück in die Gewinnspur findet: „Anstatt sich auf juristische Gefechte gegen chinesische Wettbewerber zu fokussieren, wäre es wesentlich, sich um die strukturellen Nachteile der kostenintensiven Fertigungen in Deutschland und den USA zu kümmern“, empfiehlt er Nitzschke widerspricht, Solarmodule seien kein „Commodity“-Produkt, bei dem nur noch der Preis eine Rolle spiele. Um die Konkurrenzfähigkeit und Modernität seiner deutschen Produktion zu demonstrieren, hat Solarworld Anfang Mai eigens die Fabriktore für Journalisten geöffnet (siehe Kasten, Seite 44).
Die Firma argumentiert, dass Konkurrenzfähigkeit von fairem Wettbewerb abhängig sei, wovon aber nicht die Rede sein könne. Nach Analysen von Angeboten durch die Marktforscher von EuPD Research kosteten Systeme von Solarworld im Februar immerhin nicht mehr als die mancher chinesischer Wettbewerber. Ob dafür Solarworld wie manch anderer Hersteller unter Produktionskosten verkaufe, wollte Nitzschke nicht sagen, ebenso ob der Konzern 2012 wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehre. Dazu sei das Umfeld zu unsicher.
„Der Atem der europäischen Hersteller, um Preisverfall und Überkapazitäten zu überstehen, ist nicht so lang wie der der Chinesen“, schätzt Analyst Henning Wicht von iSuppli. In China stünden immer noch Investoren mit frischem Kapital bereit, um in neue Kapazitäten zu investieren. Einzelne Provinzregierungen unterstützten diese Politik. Dazu komme der Preisverfall bei den Maschinen. „Für die gleiche Summe erhalten heute Investoren die doppelte Kapazität als noch vor zwei Jahren.“ All das seien Gründe, warum Unternehmen wie
Canadian Solar und LDK Solar ihre Produktion aktuell weiter ausbauten und damit eine Politik fortsetzen, die zuvor von Firmen wie Suntech oder Yingli betrieben worden war.
Dennoch gehen die Lichter in den deutschen Solarfabriken noch nicht aus, wie das Beispiel Bosch zeigt. „In Deutschland zu produzieren lohnt sich nach wie vor“, sagt Bosch-Solar-Energy-Sprecherin Heide Traemann, die das Ziel des Elektro-Spezialisten klar umreißt: „Wir wollen zu den Gewinnern des weltweiten Ausleseprozesses zählen.“ Wichtig ist dafür aktuell zweierlei: ein finanzstarker Konzern im Hintergrund, der auch ein paar Verlustjahre wie aktuell überstehen hilft. Zugleich ist Vertriebsstärke gefragt, um ein in Europa rückläufiges Geschäft kompensieren zu können. „Unser weltweites Vertriebsnetz wird für den Absatz von Solarstromtechnologie immer wichtiger. Wir müssen in den wachsenden Solarmärkten etwa in Asien nicht erst eigene Büros eröffnen. Bosch ist dort teils seit Jahrzehnten vertreten.“ Statt Deutschland als Produktionsstandort in Frage zu stellen, hat die Firma die Pläne für die Fabrik in Malaysia verschoben. „Die unmittelbare Nähe zu Universitäten, Forschungszentren und Zulieferern ist ein enormer Standortvorteil für Deutschland“, sagt Traemann.
„Es geht darum, den Kunden künftig gegenüber dem Wettbewerb aus China einen Mehrwert anzubieten“, sagt Analyst Wicht. Wer als internationaler Generalunternehmer auftritt, der schlüsselfertige Konzepte anbietet, kann auch seine in Deutschland produzierten Zellen und Module besser verkaufen, weil er eine längere und margenstärkere Wertschöpfungskette abdeckt als ein reiner Produzent.
Zunehmend wichtig sei außerdem die Kooperation mit einem Versicherer, der auch für den Fall geradestehe, dass das Unternehmen in 20 Jahren nicht mehr existiere. „Das schafft Kundenvertrauen“, glaubt Wicht (siehe auch Interview Seite 170). Die sprachliche Nähe zu einem in diesem Bereich führenden Versicherer wie der Münchener Rück sei ein Vorteil für deutsche Firmen.
Technologievorteil ausspielen
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es nach Ansicht von Peter Fath, Technologievorstand beim Anlagenbauer Centrotherm, aber vor allem unumgänglich, die Technologiekarte auszuspielen. „Aufgrund der Nähe zu den Forschungsinstituten und den Maschinen- und Technologielieferanten und wegen der hierzulande sehr gut ausgebildeten Ingenieure müsste es gelingen, immer im Mittel 0,1 bis 0,2 Prozent höhere Wirkungsgrade bei Zellen und Modulen zu erzielen als die Wettbewerber in China“, sagt er. „Außerdem sollten die hiesigen Ingenieursqualitäten auch eine bessere Performance der gesamten Produktionslinie möglich machen, was zu höheren Ausbeuten, höherer Verfügbarkeit und höherem Durchsatz führt.“ Auch bei den Kosten seien Einsparungen drin, sagt Fath, dessen Unternehmen für sich in Anspruch nimmt, „die Struktur der Herstellungskosten sehr gut“ zu kennen, „weil wir sowohl nach China als auch nach Deutschland verkaufen“. So zahlten deutsche Firmen beim Einkauf von Verbrauchsmaterialien für kristalline Solarprodukte wie Pasten, Gase oder Chemikalien im Schnitt 10 bis 15 Prozent mehr als chinesische Wettbewerber, und zwar an die gleichen internationalen Lieferanten. Hintergrund sei neben der Einkaufsmacht Chinas der Umstand, dass die Anbieter beim Einstieg in den chinesischen Markt Sonderkonditionen angeboten hätten, die teils heute noch gelten würden. Durch geschickte Einkaufsstrategie könnten aber auch deutsche Firmen die gleichen Konditionen erzielen, schätzt Fath. Als vierten Punkt nennt er das Interesse vieler Unternehmen an Sonderausstattungen der Maschinen, die die Anlagen teurer als Standardprodukte machten. Dieser Kostenaufschlag lasse sich angesichts von Überkapazitäten kaum noch rechtfertigen und führe zu erhöhten Abschreibungen.
Wer diese Punkte alle berücksichtige, schaffe es, auch mit einer Produktion kristalliner Zellen und Module in Deutschland gegenüber China konkurrenzfähig zu bleiben. „Wir schätzen, dass eine hiesige Fertigung dann zwar immer noch fünf bis zehn Prozent teurer ist; aufgrund des technologischen Mehrwerts „made in Germany“ wäre das aber gegenüber den Kunden zu rechtfertigen.“
Alternativen in Deutschland
Akut helfen Faths Empfehlungen allerdings nicht, in die Gewinnspur zurückzufinden. „Im Moment schreibt keine Firma angesichts der ungesunden Preise schwarze Zahlen, auch nicht in China“, sagt Knud Clausen von Innotech Solar. Auch die Norweger, die seit einem Dreivierteljahr über die Tochter ITS eine nagelneue Zellfertigung in Halle an der Saale unterhalten, sind da keine Ausnahme. Ein Verkaufspreis von rund 80 Cent je Watt sei aktuell nötig, damit sich die Fertigung in Deutschland rechne, räumt der Produktmanager ein. Dennoch bereue Innotech die Investition hierzulande nicht.
Das liegt vor allem daran, dass Innotech eine Nische besetzt, die die Chance hat, dauerhaft profitabel zu sein. „Man muss irgendetwas anders machen als der Mainstream, sonst lohnt sich ein Engagement nicht.“ Die Firma verwertet den Ausschuss anderer Zellhersteller, der über optische oder elektrische Fehler verfügt. In den letzten Monaten wurden 120 verschiedene Zelltypen dieser „Non-prime“-Ware von rund 40 Herstellern qualifiziert. Durch die Isolierung von Kurzschlüssen, den sogenannten Shunts, mit einer eigens entwickelten Lasertechnologie gelingt es ITS, leistungsstabile Zellen herzustellen, die bei einer Schwestergesellschaft in Schweden zu Modulen von 20 bis 290 Watt weiterverarbeitet werden.
Gerade in der aktuellen Situation gebe es keinen Mangel an den Vorprodukten, berichtet Clausen. „Die derzeitige Marktlage sorgt für ein enges Fenster bei den Herstellern.“ Kleinste Fehler bei den Zellen würden sofort aussortiert. Anfangs habe ITS vor allem Q-Cells- und Bosch-Zellen verarbeitet. Die Lieferungen aus dem nur wenige Kilometer entfernten Q-Cells-Standort in Bitterfeld-Wolfen hielten zwar auch nach Eröffnung des vorläufigen Q-Cells-Insolvenzverfahrens an. Dennoch versuche sich ITS „breiter aufzustellen“. Die Zellen von acht bis zehn Herstellern würden aktuell verarbeitet. Darunter sei nur ein asiatisches Unternehmen.
Platz ist in den von einem süddeutschen Maschinenbauer ausgerüsteten Hallen noch genug. Bisher arbeitet ITS ausschließlich mit einer weitgehend automatisierten Laserproduktionslinie. Damit sollen wie geplant im laufenden Jahr Zellen mit einer Leistung von 80 Megawatt aufgearbeitet werden. Doch weitere Verfahren unter Einsatz von Chemikalien sind in der Entwicklung, um ab 2013 in die Produktion überführt zu werden. „Wir machen hier alles Schritt für Schritt. Diskussionen über eine Verlagerung der Produktion nach Asien führen wir nicht“, so Clausen. Völlig ausschließen wollte er eine solche Maßnahme aber auch nicht. „Einsparungen wären nur noch bei den Personalkosten möglich“, räumt er ein.
Dünnschicht mit Chancen
Auch der Hersteller von Dünnschichtzellen und -modulen Avancis hat seine Fertigung in Deutschland ausgebaut. Konkrete Angaben zu Modulkosten und -preisen will Hartmut Fischer nicht machen. Doch der Vorstandschef des Torgauer CIS-Produzenten ist sich sicher, dass die Fertigung seiner schwarzen Module auf Basis von Kupfer, Indium, Gallium und Selen in der deutschen Fabrik auf Dauer rentabel sein wird.
Eine Zielvorgabe, ab wann die Tochter des französischen Glas-Konzerns Saint-Gobain schwarze Zahlen schreiben muss, gebe es seitens des Großaktionärs zwar nicht. Doch zum Geldverbrennen hat der Eigentümer den Technologielieferanten ebenso wenig ausgestattet.
Vielmehr sehe Saint-Gobain in Avancis „einen Pilotkunden für technische Gläser“. Mittelfristig, so die Argumentation, soll das Solargeschäft für den Glasspezialisten ein wichtiger Absatzkanal werden. „Wir profitieren davon, dass wir einer der wenigen vertikal integrierten Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen sind“, sagt Technikvorstand Franz Karg. Saint-Gobain liefere ein zugeschnittenes Vorprodukt, auf dem sich bereits die Rückelektrode, eine hauchdünne Lage aus dem Metall Molybdän, befinde. Auch bei den folgenden Prozessschritten stamme viel Know-how aus dem Konzernverbund. Mittlerweile kann die Firma auf erste elementare Kostenfortschritte verweisen. Die seit Anfang des Jahres am gleichen Standort arbeitende zweite Fabrik mit einer Kapazität von 100 Megawatt produziere das Modul „nur noch halb so teuer“ wie die erste mit 20 Megawatt, sagt Fischer. Ein höherer Automatisierungsgrad, neue Maschinen und die Erfahrungen mit der ersten Linie nennt er als Gründe. „Wir fangen gerade erst an und müssen noch viel Innovation bringen.“ Fischer rechnet damit, den Wirkungsgrad bis Ende des Jahres um einen halben Punkt auf 13 Prozent verbessert zu haben. Mittelfristig sollen die Module aus Nordsachsen 15 Prozent schaffen. Zugleich steht die Reduktion der Schichtdicken des Atomgemischs der Halbleiter von 2,5 auf 1,8 Mikrometer an. Beides wird die Kosten erheblich senken, denn die Rohstoffe sind seiner Rechnung nach der dritthöchste Aufwandsposten nach dem Glas und den Abschreibungen. Der Lohnkostenanteil liege dagegen nur „im einstelligen Bereich“.
Wichtiger als die Löhne sind deshalb laut Fischer die spezifischen Vorteile in Deutschland hinsichtlich Qualifikation, Forschungsnähe und Branchendichte. Am Forschungs- und Entwicklungsstandort in München – Avancis ist aus Siemens Solar hervorgegangen – arbeiteten rund 100 Ingenieure. „Das kann man nicht einfach verpflanzen.“ Auch die räumliche und sprachliche Nähe zu Zulieferern und Maschinenbauern sei ein großer Vorteil. „Wir haben für die Ausstattung unserer Fertigungslinien internationale Angebote eingeholt. 96 Prozent der Maschinen in der ersten Fabrik und 97 Prozent in der zweiten stammen dennoch aus Deutschland.“ Die enge Kooperation mit den Anlagenbauern ist deshalb so wichtig, weil in der voll integrierten Fertigung mit ihren vielen Prozessschritten noch reichliche Effizienzpotenziale schlummern. Das betrifft insbesondere die Öfen, wo ein exakter Temperaturverlauf für eine optimale Verschmelzung von Glas und Halbleitern sorgt. „Hier ist die Ingenieurstechnik besonders wichtig für die Effizienz.“ Ohne eine gewisse Technologiereife, so Fischer, sei die Produktion von CIS-Modulen nicht möglich. Das ist mehr als eine Hoffnung für die heimische Solarindustrie. Für solare Märchen wie in der Vergangenheit ist die Zeit aber endgültig abgelaufen.